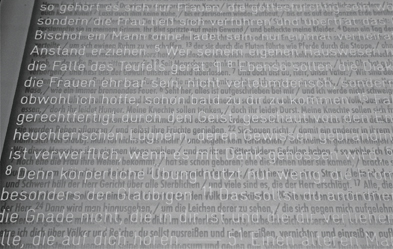
Am 9. Mai 2015 wurde der größte Kirchenneubau in Ostdeutschland seit der friedlichen Revolution, die katholische Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig, geweiht. Die Nordfenster stammen von dem Leipziger Künstler Falk Haberkorn und geben den Text der ganzen (!) Bibel in zwei Lagen wieder. Je nach Beleuchtung wird nach außen entweder der Text des Alten oder der des Neuen Testaments deutlicher sichtbar. Die Gemeinde St. Trinitatis schreibt dazu auf ihrer Homepage: "Was hat eine Gemeinde anderes auszusagen, als das Wort, das ihr mitgegeben worden ist?"
Wäre der Berliner evangelische systematische Theologe Notger Slenczka als Experte im Vorfeld befragt worden, hätte der Entwurf Haberkorns wohl keine Chance gehabt. Die Fenster (siehe nächste Seite) bringen die beiden Testamente mit jeweils gleicher Dignität miteinander ins Spiel. Slenczka hingegen argumentiert für ein Gefälle in der Bedeutung und Normativität der beiden Testamente.
Freilich: Es wurde immer weniger, was Notger Slenczka seit seiner 2013 veröffentlichten akademischen "Provokation" behauptet und fordert. Noch 2013 vertrat er die Überzeugung, dass das Alte Testament eine kanonische Geltung in der Kirche nicht mehr haben sollte und schloss daraus: "Damit ist aber das AT als Grundlage einer Predigt, die einen Text als Anrede an die Gemeinde auslegt, nicht mehr geeignet." Letztlich wäre diese Konsequenz auch nur folgerichtig, denn der Begriff "Kanon" ergibt im Blick auf die Bibel primär dann Sinn, wenn es um die Bedeutung des Textes für die kirchliche Praxis geht. Kanonisch sind Bücher nicht, weil sie in der theologischen Diskussion bedacht, sondern in der Kirche gelesen und gepredigt werden - immer in der Erwartung, dass in, mit und unter diesen Texten etwas hörbar werden kann und wird, was sich als "Wort Gottes" bezeichnen lässt.
Inzwischen aber erklärt Slenczka, dass "niemand" fordere, "dass das Alte Testament nicht mehr im Gottesdienst gelesen und dass nicht mehr über dasselbe gepredigt wird" (siehe zeitzeichen 6/2015). Eigentlich wäre die Zeit gekommen, in der Slenczka auch erklären könnte: "Ja, ich bin zu weit gegangen mit dem, was ich vor gut einem Jahr behauptet habe! Mein Versuch, dem Alten Testament die kanonische Bedeutung abzusprechen, war ein theologischer Irrtum."
So weit, dies einzuräumen, ist Slenczka noch nicht. Geht es dann in der Diskussion also doch nur um den - unbestreitbar kirchlich immer notwendigen - Diskurs über die Bedeutung des Alten Testaments innerhalb des zwei-einen biblischen Kanons? Im Wesentlichen ist es wohl so. Weil Slenczka dabei aber überaus problematisch argumentiert, versuche ich im Folgenden eine Widerlegung und plädiere für die Lust an der Lektüre der Bibel in ihrer zwei-einen kanonischen Gestalt.
Text minderen Ranges
Ein Ausgangspunkt für Slenczka in allen seinen Veröffentlichungen zum Thema ist "der gegenwärtige kirchliche Umgang" mit dem Alten Testament, den der Verfasser zu kennen scheint. Dieser sei dadurch gekennzeichnet, dass "wir" diesen Texten einen minderen Rang zubilligen und äußerst selektiv mit ihnen umgehen würden. In früheren Veröffentlichungen meinte Slenczka noch, dies geschehe, weil das christlich-fromme Selbstbewusstsein angesichts des dort Gesagten "fremdele" (eine Wortwahl, von der er sich inzwischen ebenfalls verabschiedet hat).
Augenscheinlich lässt sich Notger Slenczka durch empirische Studien in seiner Wahrnehmung der Wirklichkeit wenig verunsichern. Denn sonst müsste er erkennen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer, Prädikanten und Kirchenmusiker kaum etwas mehr wünschen, als mehr Texte aus dem Alten Testament im Gottesdienst lesen und predigen zu dürfen. Das 'christlich-fromme Selbstbewusstsein' scheint sich vielen dieser Texte ausgesprochen nah zu fühlen.
In seinem Beitrag in zeitzeichen 6/2015 bezieht sich Slenczka auf einen Bibeltext aus dem Alten Testament, der zu den Predigttexten für den Sonntag Rogate gehört: Exodus 32,7-14, die Fürbitte des Mose für das Volk in der Wüste. Slenczka behauptet: "Wer darüber predigen will, gerät in Schwierigkeiten." Ich weiß nicht, woher er das weiß. Denn er ignoriert die Fülle an anregenden, herausfordernden Predigten, die gegenwärtige christliche Lebens-, Welt- und Gotteserfahrung mit diesem Text in Beziehung bringen und die sich schon nach kurzer Recherche im Internet greifen lassen. Gerät - so ließe sich fragen - bei einem Text wie diesem nicht eher der Systematiker "in Schwierigkeiten", der ein viel zu enges Bild vom Wechselspiel des Alten und des Neuen Testamentes hat und der diese vielfältige und anregende Erzählung nur in dem Schema der "Antithetik" zwischen Mose und Christus wahrnimmt?
In freilich einer Hinsicht hat Slenczka schon recht: Das Alte Testament wird gegenwärtig nicht in Gänze rezipiert (das Neue Testament natürlich auch nicht!). Generell gilt aber: Es gab noch nie eine Zeit in der Geschichte der Kirche, in der der Kanon der Bibel in seinem gesamten Umfang rezipiert worden wäre - wie sollte das angesichts der schieren Textmenge auch möglich sein? Wenn wir daher von Kanon sprechen, so gilt es immer, dessen Doppelgestalt wahrzunehmen: Einerseits ist er das, was sich zwischen zwei Buchdeckeln finden lässt; andererseits lebt er in einer Fülle unterschiedlicher Kanones, die individuell oder in kleineren Gruppen oder in größeren kirchlichen Gemeinschaften existieren. Dabei aber läuft nicht etwa eine dicke Demarkationslinie zwischen dem Alten und Neuen Testament quer durch die Bibel, vielmehr nutzen die faktischen Kanones alttestamentliche und neutestamentliche Texte in vielfältiger Auswahl.
Bei der faktischen Textrezeption in den Kirchen, aber auch im Leben einzelner Christenmenschen oder in der kulturellen Landschaft, spielt die Frage, ob diese Texte auf einem historischen Zeitstrahl vorchristlich sind oder nicht, eine erstaunlich geringe Rolle. Für Slenczka aber wird diese Frage zu der entscheidenden. Er sucht, wie er selbst in zeitzeichen schreibt, nach einer "eindeutigen Zuordnung des Alten und des Neuen Testaments". Er sucht nach dem Generalschlüssel, mit dem er die Vielfalt der Texte des Alten Testaments aus christlicher Perspektive erschließen kann. Dabei wird das Alte Testament als "Zeugnis des vorchristlichen Selbst-, Welt- und Gottesverständnisses" wahrgenommen, auf das dann die radikale Umwertung durch Jesus Christus folgt. Diese Umwertung werde greifbar in den neutestamentlichen Texten, wobei es sich bei diesen, so Slenczka, um einen "Impuls" handelt, der "im Laufe der Jahrhunderte [...] immer klarer in seiner Bedeutung für das christliche Selbst-, Welt- und Geschichtsverständnis ausgearbeitet" worden sei.
Damit schließt sich Slenczka einem linearen und fortschrittsoptimistischen Geschichtsbild an, wie es auch Schleiermacher vor zweihundert oder Adolf von Harnack vor einhundert Jahren entwickelten. Mir stellt sich dabei die Frage, warum im Abstand von jeweils etwa 100 Jahren an Berliner theologischen Schreibtischen augenscheinlich die Einsicht reift, jetzt sei das entscheidend Christliche so klar erkannt, dass man aus einer höheren Warte das Alte Testament theologisch einordnen und dessen Texte in ihrer Bedeutung relativieren könnte. Als könne sich das christlich-fromme Selbstbewusstsein nun so klar artikulieren, dass es auf die ständige Hinterfragung durch die Texte des biblischen Kanons eigentlich nicht mehr angewiesen ist.
Die Weisheit der Kanonsentscheidung seit der Alten Kirche und der reformatorischen Einsicht in die Bedeutung der Bibel für die immer neue Konstitution des Glaubens (sola scriptura) liegt demgegenüber darin, dass sich das, was Christus bedeutet, nicht ohne die Texte des Alten und Neuen Testaments aussagen und verstehen lässt. Schon das erste Kapitel des Neuen Testaments zeigt den Stammbaum Jesu auf und katapultiert lesende Christenmenschen zurück in das Alte. Texthermeneutisch heißt das: "Altes und Neues Testament stehen sich [...] nicht als zwei 'Blöcke' gegenüber, von denen man Letzteres auch ohne Ersteres haben könnte. Es handelt sich vielmehr um eng aufeinander bezogene Textsammlungen, die gemeinsam den Traditions- und Deutungsraum des Christusglaubens bilden" (Jens Schröter). Ohne das Alte Testament hinge christliche Existenz in der Luft und wäre auf ein subjektives und punktuelles Erlösungsgeschehen oder ein überaus freundliches, aber doch auch einigermaßen dünnes und banales "Wesen des Christentums" reduziert, wie es Adolf von Harnack vor gut einhundert Jahren konstruiert hat.
Jüdische Signatur
Der hermeneutische Generalschlüssel funktioniert nicht. Dass sich hier Vorchristliches zu Christlichem verhalte, ist ein Konstrukt. Das Christliche trägt von Anfang an und bleibend die Signatur des Jüdischen, ist eingeschrieben in eine Geschichte, die zugleich die Geschichte einer anderen Religion ist. Das Alte Testament ist daher weit mehr als ein formaler "Platzhalter für die vorchristliche Gotteserfahrung aller Zeiten", wie Slenczka jüngst geschrieben hat. Vielmehr ist das Alte Testament konstitutiv für christliche Identität.
Christenmenschen leben als die, die sie sind, in einer bleibenden Spannung: Sie sind nicht Israel und erfahren sich durch das Christusereignis doch als Adressaten von Israels Verheißung und Hoffnung. Das christlich-fromme Selbstbewusstsein hat gleichsam immer (und nur eschatologisch heilbar) einen Riss. Sobald wir als Christenmenschen unsere Geschichte mit Gott erzählen, sind wir darauf angewiesen, uns in die Geschichte Israels hinein zu erzählen und zu wissen: Das ist auch unsere Geschichte - und bleibt zugleich eine fremde Geschichte und ein Gegenüber.
Das heißt aber: Wir können nicht Christen sein, ohne auf das Judentum bezogen zu bleiben. Und daraus folgt, so schwierig und theologisch mühsam das auch sein mag: Auch das jüdische "Nein" zu Jesus als dem Christus ist ein beständiger Teil christlicher Identität, der mit dem christlichen "Ja" in Spannung steht. Dietrich Bonhoeffer hatte schon Recht, als er in seiner Ethik schrieb: "Der Jude hält die Christusfrage offen." Das ist anstrengend - und zugleich verheißungsvoll, weil wir damit auch mit der Frage, wer Christus ist und was er bedeutet, nie zu Ende kommen, sondern immer genötigt sind, neu zu suchen und zu fragen. Christliche Identität bleibt vor jedem Imperialismus des Habens bewahrt und gerade so auf das lebendige Judentum bezogen, das weit mehr als nur "religionsgeschichtliche Voraussetzung" ist.
Damit steht auch die Systematische Theologie vor der Aufgabe, nicht in allzu schlichte, vereinfachende und gescheiterte hermeneutische Modelle der theologischen Tradition zurückzufallen, sondern sich kreativ an der Suche nach einer komplexen Hermeneutik zu beteiligen, die sich in das unauflösliche Wechselspiel der Testamente verstrickt. Dabei gilt: Der zwei-eine Kanon mit seinen vielfältigen Texten ist auch ein "Schutzraum der Pluralität" (Albrecht Grözinger) und hält so bewusst vielfältige Lesarten offen. Das Nordfenster der Leipziger Trinitatiskirche verbindet die Testamente und bringt sie in neue Wechselspiele. Dass das Alte Testament dabei kleiner gedruckt ist als das Neue, liegt nur daran, dass es die größere Textmenge enthält. Es gibt viel in ihm zu entdecken! Wer weiß: Vielleicht führt die gegenwärtige, in vieler Hinsicht merkwürdige Diskussion um die Kanonizität des Alten Testaments ja - ein wenig paradox - dazu, dass die Texte aus dem Altem (und dem Neuem!) Testament mit neuer Leidenschaft gelesen werden und dass die Bibelleselust einen kräftigen Schub erfährt!
Notger Slencka zum Streit um seine Thesen
Alexander Deeg
Alexander Deeg
Prof. Dr. Alexander Deeg, geb. 1972, lehrt Praktische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Leipzig und leitet das Liturgiewissenschaftliche Institut der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD).



