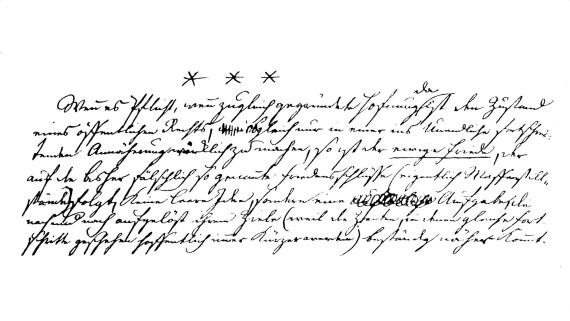Ein anderes Leben entdecken

Im rheinischen Wickrath nahe Mönchengladbach, wo ich in den Achtzigerjahren Pfarrerin war, konnte ich die Entwicklung besonders gut verfolgen. Damals gründeten wir dort den Gemeindeladen als Ort der Begegnung und der gegenseitigen Unterstützung: mit Kinderbetreuung und Spielkreisen als Angebot für die jungen Familien, die keinen Kindergartenplatz für ihre Jüngsten fanden, als Kleiderkammer für Menschen mit wenig Geld, als Begegnungsstätte mit Café und Beratungsangebot. Diejenigen, die sich damals dort engagierten, haben heute neue Initiativen ins Leben gerufen, darunter das Seniorennetzwerk 55+, das sich unter anderem für die Entwicklung der alternsgerechten Stadt einsetzt.
Selbstbewusst, kritisch und noch immer voller Energie gehen diese so genannten Power-Ager in die neue Lebensphase. Die stille Verachtung für das Alter hat diese Generation ebenso hinter sich gelassen wie die traditionellen Rollen. Ja, sie sind gern Großeltern - für die eigenen Enkel und auch für andere Kinder -, aber sie sind nicht jederzeit verfügbar. Ja, sie engagieren sich gern, aber nicht als billiger Jakob, wo eigentlich hauptamtliche Unterstützung gefragt wäre. Nein, einfach nur ausruhen wollen sie nicht. Tatsächlich werden sie gerade jetzt besonders gebraucht - nicht nur für die Integration Zugewanderter. Und sie sind umworben. Sportvereine und Parteien, Schulen und Hospizvereine wissen: Mit den Angehörigen dieser so gesellschafts- und politikerfahrenen Generation lässt sich einiges auf die Beine stellen.
Die Kirche hat einen guten Zugang zu dieser Gruppe. Fast vierzig Prozent der evangelischen Bürgerinnen und Bürger über sechzig nehmen nach eigener Aussage in irgendeiner Weise am Gemeindeleben teil. Damit liegt die Kirche weit vor anderen Organisationen. Freiwillige über 65 organisieren sich in Kirche und Religion stärker als in irgendeinem anderen Bereich, auch hier liegt die Kirche vorne. Das ist ein Potenzial. Und auch eine Herausforderung.
Auch die Kirchengemeinden verändern sich - wie die Wohnquartiere und Nachbarschaften. Neben dem demografischen Wandel spielen wachsende Mobilität und Migration eine Rolle. Zudem sind viele, gerade jüngere, Bürgerinnen und Bürger nicht mehr Kirchenmitglieder. So kann auch die alte Heimat fremd werden - im Ruhrgebiet genauso wie in den schrumpfenden Regionen der Uckermark - und damit geht das Identifikationsgehäuse verloren, der Ort, an dem wir uns geistig, emotional und kulturell zu Hause fühlen und einen Referenzrahmen für Austausch und Teilhabe finden. Kirche ist ein solcher Referenzrahmen: Mit ihren Gebäuden und ihren Mitarbeitenden, mit ihren Traditionen und ihrer vielfältigen Vernetzung kann sie eine wichtige Aufgabe im Quartier erfüllen.
Der indische Theoretiker Homi Bhabha hat das Konzept des „dritten Ortes“ entworfen, eines Ortes, der keiner Gruppe eindeutig zuzuschreiben ist, an dem sich die Verschiedenen ohne Hierarchisierung begegnen und ihre Anliegen aushandeln können. Dritte Orte sind leicht zugänglich und offen; eine Reservierung ist nicht nötig, die Teilnahme kostet nichts. Die Kirche mit ihren Pfarrgärten, Gemeindehäusern, Nachbarschaftsläden kann diese Rolle spielen. Davon ist jedenfalls Klaus Dörner überzeugt, der Mediziner und Sozialpsychiater, dem es auch selbst wichtig ist, dort zu leben und zu sterben, wo er dazugehört - auch, wenn er hilfsbedürftig würde. Dazu müssen Gemeinden sich allerdings öffnen, sich nicht nur als Gastgeber verstehen, sondern auch als Dienstleister: am besten als Gemeinde mit der Diakonie zusammen den „dritten Sozialraum“ entwickeln.
Wie zum Beispiel in Hamburg-Altona. Dort ist die Diakonie einer der Partner, die das Projekt Altonavi gegründet haben, eine barrierefreie offene Quartiersberatungsstelle mit vier Mitarbeiterstellen - mitgesponsert von der Stadt, aber auch vom Stadtteilzentrum HausDrei, der Arbeiterwohlfahrt und vielen anderen Trägern. Die Mitarbeitenden von Altonavi informieren über öffentliche Unterstützungsangebote und bringen Hilfesuchende und Hilfeanbietende zusammen, beispielsweise für die Begleitung bei Arztbesuchen, für Hausaufgabenhilfe oder eine Beratung, wenn Angehörige an Demenz erkrankt sind.
Ältere spielen hier eine besondere Rolle, nicht nur weil sie freier über ihre Zeit verfügen können, sondern mit ihren über Jahrzehnte beruflich und privat erworbenen jeweils spezifischen Kompetenzen, auch als Kennerinnen und Kenner des Quartiers. Denn sie sind oftmals schon über viele Jahre dort verwurzelt und können als Mittler zu neuen Gruppen fungieren: in der Arbeit mit Flüchtlingen, durch das Vermieten von Zimmern an Studierende, durch Stadtteilführungen. Viele engagieren sich auch, um die Eckpfeiler des öffentlichen Raums und des nachbarschaftlichen Lebens aufrechtzuerhalten, etwa Dorfläden, Nachbarschaftscafés oder Bürgerbusse. Und immer öfter spielen auch digitale Netzwerke eine Rolle, wie etwa die „mobile Nachbarschaft“, die Nachbarn dabei unterstützt, sich für alltägliche Bedarfe und Dienstleistungen zu vernetzen.
Lust auf Leben
„Sorgende Gemeinschaften“ - ein Konzept, das aktuell im Alten- und im Engagementbericht der Bundesregierung Karriere macht - können sicherstellen, dass Menschen nicht in ein Heim umziehen müssen, nur weil sie sich nicht mehr selbst versorgen können. Wo sorgende Gemeinschaften funktionieren, löst sich das Gefälle zwischen Gebenden und Nehmenden auf, beispielsweise in Mehrgenerationenhäusern, wo Hausaufgabenhilfe gegen Einkaufsdienste oder Babysitten gegen Gartenarbeit getauscht werden. Und vielleicht auch Zuhören gegen Aktion. Die Prädiktoren für die fernere Lebenserwartung seien nicht vorrangig im Blutdruck und Cholesterinspiegel zu suchen, meint der Vorsitzende der Engagementkommission, Thomas Klie (siehe Interview Seite 34), sondern in der Qualität sozialer Netzwerke.
Aber sorgende Gemeinschaften brauchen Sorgestrukturen. Die evangelische Kirchengemeinde Lindlar im Rheinisch-Bergischen Kreis hat vorgemacht, wie das geht: Sie nahm nicht nur die Situation ihrer Mitglieder unter die Lupe, sondern auch die der Immobilien in der Gemeinde. Und sie zog Konsequenzen. Die Kirche auf dem Hügel, die erst nach dem Krieg für die Heimatvertriebenen gebaut worden war, füllte sich nicht mehr wie früher. Viele Gemeindemitglieder waren älter geworden, sie brauchten Hilfe, um das Haus zu verlassen. Es fehlten alternsgerechte Wohnungen, Haushaltshilfen, aber auch ein Ort der Begegnung zwischen den Generationen. So entschied sich der Kirchenvorstand für einen radikalen Neuanfang: Das Pfarrhaus auf dem Kirchenhügel wurde abgerissen und ein Teil des Landes verkauft. In Zusammenarbeit mit einer kirchlichen Wohnungsbaugenossenschaft wurden dort barrierefreie Wohnungen errichtet. Von dem erzielten Gewinn wurde das Jubilatezentrum errichtet - ein Treffpunkt der Generationen. In das Wohnprojekt zog ein Pflegedienst ein und, das war der Clou des Ganzen, mit der Hilfe des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (kda) wurde ein Aufzug hinunter in die Innenstadt gebaut, damit auch Ältere wieder die Möglichkeit hatten, gut zum Einkaufen zu kommen. Das Konzept hat die Gemeinde neu belebt. Und es hat ihren Einfluss in der Kommune gestärkt, den sie nun für die Entwicklung zur alternsgerechten Stadt nutzt.
Vielfach müssen tradierte institutionelle oder auch nur mentale Barrieren überwunden werden, um einander wechselseitig zu bereichern: zwischen Jung und Alt, beispielsweise wenn Jugendliche, die auf ihre Konfirmation zugehen, mit Goldkonfirmandinnen und -konfirmanden ein Wochenendprojekt zum eigenen Konfirmationsspruch organisieren. Zwischen Kirchengemeinde und anderen kulturellen Gruppen, beispielsweise in der Zusammenarbeit mit der Moschee oder in der Kulturvermittlung. Zwischen Kirche und Diakonie, etwa wenn sich die diakonische Professionalität in einem Projekt mit bürgerschaftlichem Engagement verbindet.
Wer sechs und mehr Jahrzehnte Leben hinter sich hat, dem muss man nicht erklären, wie das Leben funktioniert. Aus Berufstätigkeit und Familie, aus Vereins- und Nachbarschaftserfahrungen und nicht selten auch aus politischem Engagement bringen die Leute Kompetenzen mit, die sie oft gern in neue Kontexte einbringen. Dafür gilt es in den Gemeinden, Raum zu geben und Raum zu schaffen: mit zugänglichen Kirchenräumen, klaren Kompetenzen für Ehren- wie Hauptamtliche und mit transparenten Strukturen im Blick auf Konzepte, Finanzierung und Entscheidungen. Annegret Zander von der Fachstelle Zweite Lebenshälfte der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck ermutigt dazu, den Seniorenkreis abzuschaffen, wo er nicht mehr gefragt ist. Natürlich nicht ohne den langjährigen Mitarbeitenden zu danken. Dafür mit Mut zur Offenheit und zur Lücke. Denn nach einem erfüllten und oft auch anstrengenden Leben in Beruf und Familie wollen sich die jungen Alten nicht nur versorgen oder betreuen lassen, sie haben vielmehr Lust auf Leben und einen neuen Aufbruch. Die Klage mancher Gemeinden, dass sie die jungen Alten mit ihren Angeboten nicht erreichen, verweist auf eine andere Wirklichkeit: Wer jetzt viel reist, ein Zweitstudium beginnt oder eine neue Initiative startet, will alten Träumen nachgehen, etwas Neues lernen, ein anderes Leben entdecken, gern mit anderen. Dabei geht es auch um Spiritualität.
Lars Tornstam, der in Schweden Untersuchungen zur Spiritualität älterer Menschen durchgeführt hat, spricht von Ego-Transzendenz oder auch Gero-Transzendenz. Das Alter bietet die Chance, sich selbst zu überschreiten. Transzendenz hat es nicht nur mit dem Jenseits zu tun. Vielmehr geht es darum, sich grundsätzlich für ganz neue Möglichkeiten offen zu halten. Wesentlich zu werden - aber nicht einfach auf den bekannten Kern zu schrumpfen, sondern einem neuen Samen Raum zum Leben zu geben. Dieses Interesse kann in der Kirche auf fruchtbaren Boden fallen. Es braucht Orte, Ermöglicher und Brückenbauer - praktisch, wie in der Seelsorge.
Die Kirchen können viel dazu beitragen, die gesellschaftliche Reserviertheit gegenüber dem Alter, die manchmal gar nicht so heimliche Verachtung der Älteren - vor allem der alten Frauen - aufzulösen, wenn sie ihre Rolle in den Gemeinden angemessen würdigen. Dabei können wir auf eine reiche Tradition zurückgreifen. Schließlich spielten die Ältesten und die Witwen schon immer eine wichtige Rolle. Und wie in den Mehrgenerationenhäusern war Gemeinde immer schon Familiaritas über die Herkunftsfamilie hinaus. Leihomas und die Mentorate wachsen aus einer Wurzel. Und dieser Traditionsfluss ist nach wie vor vital: Es gibt viel zu gewinnen, an Lebendigkeit, Austausch und Ermutigung - für die Älteren, aber auch für die Gemeinden selbst. Die Apostelgeschichte erzählt von der Gemeinde in Jerusalem als einer sorgenden Gemeinschaft: Regelmäßig kam man dort an einem Tisch zusammen, so wie heute in Kochgruppen und an Mittagstischen. Damals waren es die griechischen Witwen, die, fast unsichtbar, ganz unten saßen, dann aber - mit ihrer Bedürftigkeit - einen Prozess in Gang setzten, der die Gemeinde wachsen ließ. Jeden mit seinen Gaben sehen, teilen und Beteiligung zulassen, das ist das Geheimnis. Auch heute.
Cornelia Coenen-Marx
Cornelia Coenen-Marx
Cornelia Coenen-Marx ist Oberkirchenrätin a. D. Nach Eintritt in den Ruhestand machte sich Coenen-Marx 2015 mit dem Unternehmen „Seele und Sorge“ selbständig, um soziale und diakonische Organisationen sowie Gemeinden bei der Verwirklichung einer neuen Sorgeethik zu unterstützen.