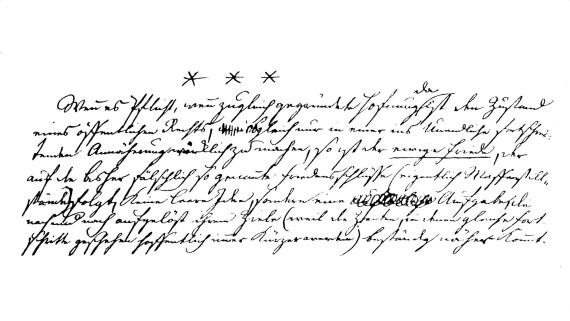Wer in der Kirche ehrenamtlich mitarbeitet und wer dabei noch Leitungsfunktionen übernimmt, merkt rasch: die Kirche hat ihre eigene Logik. Hatte man sie bisher aus einer gewissen Distanz wahrgenommen und wurde in den Kirchengemeinderat gewählt, dann ist man manchmal irritiert. In der Kirche gelten bestimmte Spielregeln, Gepflogenheiten oder Selbstverständlichkeiten, die sich nicht auf den ersten Blick erschließen. Dies gilt natürlich in jeder gewachsenen Kultur mit ihren eigenen Kommunikationszusammenhängen, Abläufen und Regelungen. Aber über solche individuellen Besonderheiten hinaus gibt es strukturelle Besonderheiten der evangelischen Kirche, die nur aus ihrer Geschichte oder bestimmten Anliegen heraus verständlich sind. Hierfür sind Hintergrundinformationen über historische Entwicklungen der Kirche, theologische Grundentscheidungen und kirchenrechtliche Regelungen außerordentlich hilfreich. Sie können zeigen, dass die Auffälligkeiten häufig keine Merkwürdigkeit der eigenen Gemeinde darstellen, sondern strukturell bedingt sind, und auch die Spielräume abstecken, innerhalb derer Veränderungen möglich sind (siehe auch Uta Pohl-Patalong/Eberhard Hauschildt: Kirche verstehen).
Eine typische Unklarheit in der Ortsgemeinde ist beispielsweise die Frage, was und vor allem wer „Gemeinde“ eigentlich ist und was ihre Aufgabe ist. Sind wir für alle evangelischen Kirchenmitglieder im Gemeindebezirk zuständig, auch wenn sie nie zum Gottesdienst kommen? Sind wir darüber hinaus für den gesamten Stadtteil oder das Dorf zuständig? Müssen wir nicht viel mehr Menschen mit unseren Angeboten erreichen? Bilden wir als Gemeinde überhaupt eine spürbare Gemeinschaft mit innerer Verbindung aller – und wäre dies überhaupt unsere Aufgabe? Sollen wir attraktive Angebote entwickeln, die auch Menschen jenseits der Gemeindegrenzen interessieren, oder werben wir damit anderer Gemeinden Mitglieder ab?
Diese Fragen entstehen, weil die uns so selbstverständlich erscheinende Ortsgemeinde ein recht kompliziertes Gebilde ist, das es in dieser Form wohl auch nur im deutschsprachigen Raum gibt. In ihr verbinden sich unterschiedliche Aufgabenbestimmungen und Orientierungen, die zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind und auf bestimmte Herausforderungen ihrer Zeit reagieren, ohne das bisherige Alte zu überwinden. Dadurch entstehen Spannungen und Unklarheiten, die durchaus merkwürdig erscheinen, wenn man mit ihnen bisher nicht vertraut war.
Unter „Gemeinde“ wird die Ortsgemeinde oder Parochie verstanden. Und sie ist in der Tat die dominante Sozialform der Institution Kirche. Über sie wird in Deutschland die Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche organisiert, das heißt, ich bin als Kirchenmitglied automatisch Mitglied einer Ortsgemeinde. Und wenn ich eine Bestätigung meiner Kirchenmitgliedschaft brauche, wenn ich zum Beispiel Patin oder Religionslehrerin werden möchte, wende ich mich an „meine“ Gemeinde. Das funktioniert deshalb, weil die Ortsgemeinde territorial organisiert ist und der Logik des Wohnortes per Zuweisung folgt: Das gesamte Gebiet der Evangelischen Kirche in Deutschland ist in Ortsgemeinden aufgeteilt, und ihre Mitglieder werden nach ihrem jeweiligen ersten Wohnsitz als Mitglied der Gemeinde erfasst, auf deren Gebiet sie wohnen. Man kann dies ändern, wenn man einen Antrag auf Umgemeindung in eine andere Gemeinde stellt. Dies ist dann aber eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. „Gemeinde“ ist daher zunächst einmal ein Verwaltungsbezirk, über den die Kirche die Mitgliedschaft in ihr und auch die Zuständigkeit für ihre Mitglieder organisiert.
Die Konstruktion, die christliche Gemeinde territorial zu organisieren und als Verwaltungsbezirk der Kirche zu verstehen, ist jedoch weder biblisch noch theologisch zwingend. Sie ist im Laufe des Mittelalters nach und nach entstanden und reagierte auf bestimmte Herausforderungen der damaligen Zeit. Als das Christentum im vierten Jahrhundert im Römischen Reich zur Staatsreligion wurde, und sich endgültig von der jüdischen Sondergruppe zur Weltreligion wandelte, musste ein riesiges Gebiet rasch kirchlich organisiert werden, und man lehnte sich aus praktischen Gründen an die römischen Verwaltungsbezirke an. Als vor allem in Germanien – nach der flächendeckenden Missionierung zum Christentum – engmaschiger kontrolliert werden sollte, ob die Menschen auch ihre Kinder taufen ließen und zu Beichte und Abendmahl gingen, wurden sie einer bestimmten Gemeinde zugewiesen, die das kontrollieren konnte. Als die Priester vor allem davon lebten, dass Menschen sie für die Taufen, Trauungen, Bestattungen und Totenmesse bezahlten, musste geklärt werden, von wem die Geistlichen diese Gelder zu erwarten hatten.
Die territorial organisierte Ortsgemeinde ist insofern eine typische Form einer Kirche, die sich als Institution für das ganze Volk versteht und von der Zuständigkeit für ihre Mitglieder her denkt – historisch eingeordnet, entstammt sie der so genannten Vormoderne. Nun ist aber Gemeinde, wie wir sie heute erleben, viel mehr als ein kirchlicher Verwaltungsbezirk: Sie ist auch eine Gemeinschaft von Christen, die sich in ihr treffen, ihren Glauben gemeinsam gestalten und auf dessen Grundlage zum Wohl anderer handeln. Dieser zweite Charakter der Gemeinde entstand Ende des 19. Jahrhunderts. Dies war die so genannte Frühmoderne, als im Zuge der Industrialisierung Menschen in Massen in die großen Städte strömten und die Kirche es als ihre Aufgabe verstand, ihnen moralischen Halt, diakonische Unterstützung und Gemeinschaft in der Anonymität zu bieten. Die Ortsgemeinde wurde damals zum „Hort christlicher Liebe“.
Neben Amtshandlungen, Gottesdiensten, Seelsorge und Unterricht durch den Pfarrer gab es jetzt gesellige Abende, zu denen sich Menschen in ihrer Freizeit trafen, und es entstanden Gruppen und Kreise. Ehrenamtliche wurden eingesetzt, die das Gemeindeleben organisierten und gestalteten. Dabei entstand das Gegenüber von engagierten Kirchenmitgliedern – die, die zu den geselligen Abenden und den Gruppen kamen oder, noch besser, sie mit organisierten – und denen, die sich nicht engagieren und nur gelegentlich oder gar nicht in dem neu entstandenen Gemeindehaus auftauchten.
Gesellige Abende
Dabei blieb allerdings die Idee leitend, dass die Kirchenmitglieder sich in genau der Gemeinde engagieren, in der sie wohnen und sie sich nicht selbst aussuchen. Dies war auch deshalb logisch, weil es nicht vorgesehen war, dass Ortsgemeinden sich inhaltlich voneinander unterscheiden: Allen war die gleiche Aufgabe zugedacht, die nur räumlich begrenzt wurde. Dies wiederum hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert, und damit kommt ein dritter Charakter der Ortsgemeinde ins Spiel.
Für die Spätmoderne, wie unsere Gegenwart soziologisch genannt wird, ist typisch: Menschen orientieren sich heute viel unterschiedlicher als früher, entscheiden und wählen selbstbewusster aus einer immer größeren Auswahl von Angeboten und folgen weniger vorgegebenen Traditionen und Autoritäten, die ihnen etwas vorgeben. Damit erwarten sie auch von der Kirche ein Angebot, das ihnen etwas sagt und persönlich etwas gibt. Und auch die Kirche ist Teil der gesellschaftlichen Vielfalt und versucht, auf unterschiedlichen Wegen das Evangelium mit unterschiedlichen Menschen gemeinsam zu kommunizieren: Erleben die einen die christliche Botschaft eher in der Bachkantate, sehen andere sie eher im Engagement für den Stadtteil verwirklicht; für wieder andere realisiert sich Kirche vor allem in der Gemeinschaft, in der man sich austauscht, oder in Impulsen, den Alltag zu unterbrechen und Zeit für Gott und für sich selbst zu finden. Jugendliche suchen andere Formen von Kirche als Seniorinnen und Senioren, Familien möchten möglicherweise andere Gottesdienste als Singles, bestimmte Angebote interessieren eher Frauen als Männer. Die Kirche ist vielfältiger geworden und bietet Unterschiedliches für unterschiedliche Menschen an. Da jede einzelne Gemeinde damit überfordert ist, alles für alle anzubieten, entwickeln Gemeinden Profile und Schwerpunkte. Diese Entwicklung widerspricht im Grunde jedoch dem territorialen Prinzip. Denn Profilbildung ist verbunden mit einer Logik der Entscheidung: Ich wähle aus und orientiere mich daran, welche Ausrichtung einer Gemeinde mir und meinen Vorstellungen von Kirche entspricht, anstatt selbstverständlich in die Gemeinde zu gehen, in deren Gebiet ich wohne. Dies ist nicht als egozentrisches Auswahlverhalten zu verstehen, sondern als Suche nach Formen, in denen ich so in Kontakt mit dem Evangelium kommen kann, dass es sich bei mir ereignen kann.
Damit stellt sich aber die Frage nach dem Verhältnis zwischen den Kirchengemeinden und den Ortsgemeinden und anderen kirchlichen Einrichtungen, wie Frauenwerken, Evangelischen Akademien, Citykirchen, Jugendkirchen, Studierendengemeinden. Macht man sich nicht gegenseitig Konkurrenz und nimmt einander Gemeindeglieder weg? Dieses Bild kann dann entstehen, wenn man Kirche nach der Logik der Grenzen des Gemeindebezirks versteht und den kirchlichen Horizont hier enden lässt. Begreift man Kirche jedoch als Kirche Jesu Christi, die sich in bestimmten Sozial- und Organisationsformen konkretisiert, um ihren Auftrag in der Welt zu erfüllen, liegt eine andere Sicht nahe: Dann erfüllen alle Formen kirchlicher Organisation, die ja historisch gewachsen und nicht theologisch festgelegt sind, die gleiche Aufgabe auf unterschiedlichen Wegen. Sie begreifen sich als Teil der Kirche Jesu Christi von der gemeinsamen Aufgabe her, das Evangelium zu kommunizieren und freuen sich über jede Konstellation, in der dies gelingt.
Schließlich stellt sich in der Spätmoderne in verschärfter Weise die Frage, an wen sich Kirche eigentlich wendet: Welche Aufgabe hat die christliche Gemeinde gegenüber Menschen, die weder Kirchenmitglieder sind noch die christlichen Grundüberzeugungen teilen? Auch hier steht die Kirche in unterschiedlichen und durchaus widersprüchlichen Traditionen. Dies reicht übrigens bis in das Neue Testament zurück: Überliefert Markus eine offene Position Jesu mit dem Satz: „Wer nicht gegen mich ist, ist für mich“ (Markus 9, 40), kehren Matthäus und Lukas die Aussage programmatisch um: „Wer nicht für mich ist, ist gegen mich“ (Matthäus 12, 30; Lukas 11, 23), und legen damit eine Abgrenzung der Anhänger und Anhängerinnen Jesu gegenüber anderen näher. Die junge Kirche musste sich in den folgenden Jahrhunderten einerseits abgrenzen, um ihre Identität zu finden. Gleichzeitig begriff sie die Liebe zu den Nächsten, unabhängig von deren religiöser Orientierung als ihre Grundlage. Im Mittelalter stellte sich die Frage kaum, weil alle Menschen getauft und Kirche und Gesellschaft identisch waren. Von diesem Bewusstsein einer selbstverständlichen Christlichkeit aller verabschiedet sich die Kirche nur langsam. Sie erlebt dies vor allem als Abbruch und Verlust. Damit aber wird die Kirche zu einer Organisation neben anderen. Dies könnte es strukturell nahe legen, sich wie andere Organisationen nur auf die eigenen Mitglieder auszurichten und sich für Nichtmitglieder nur als potenzielle Neumitglieder zu interessieren, die man von einem Eintritt überzeugen sollte. Anders als Sportvereine hat die Kirche jedoch, theologisch gesehen, nicht die Aufgabe, Mitglieder zu gewinnen, sondern soll das Evangelium kommunizieren, und zwar mit aller Welt (Matthäus 28). In der Perspektive, dass alle Menschen Geschöpfe Gottes sind und Gott ihr Wohl und Heil will, liegt es dann doch wieder nahe, dass sich die christliche Gemeinde auf das Gemeinwohl richtet. Die vormoderne territoriale Orientierung der Gemeinde kann damit spätmodern auch als Verantwortung für das Gemeinwesen im Umfeld der Ortsgemeinde verstanden werden.
Es ist deutlich: Die Sozialform Ortsgemeinde ist ein Mischgebilde aus unterschiedlichen Logiken, die jeweils auf unterschiedliche Herausforderungen aus unterschiedlichen Zeiten antworten. Dabei können die drei Logiken in verschiedenen Gemeinden unterschiedlich stark ausgeprägt sein – mal ist sie noch deutlicher territorial orientiert, mal dominiert der Versuch zur sozialen Integration möglichst vieler, und mal richtet sie sich mit einem klaren Profil an bestimmte Zielgruppen. Da die beiden anderen Logiken aber auch vorhanden sind, werden in vielen Gemeinden Spannungen spürbar und werfen Fragen auf, wie die oben genannten. Entschieden werden sie jeweils vor Ort in einem Abwägen der Möglichkeiten und Schwierigkeiten. Orientieren sollten sich die Entscheidungen jedoch an der Frage, auf welchen Wegen in dieser Gemeinde das Evangelium die besten Chancen hat, die Menschen zu erreichen.
Information
Uta Pohl-Patalong/Eberhard Hauschildt: Kirche verstehen. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2016, 222 Seiten, Euro 19,99.
Uta Pohl-Patalong
Uta Pohl-Patalong
Uta Pohl-Patalong ist Professorin für Praktische Theologie an der Universität Kiel.