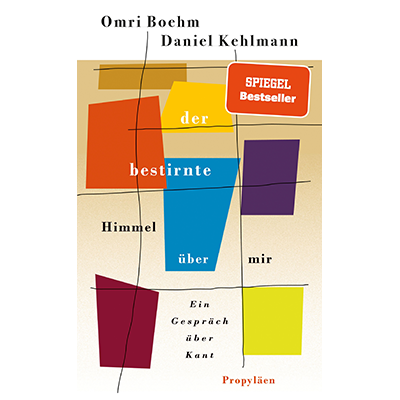Der dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard (1813-1855) hat die Angst vor der Freiheit mit einem Taumelgefühl verglichen. Wer abrupt in eine gähnende Tiefe hinabschaue, dem werde schwindelig. Ursache dafür sei einerseits der Abgrund, der sich vor ihm öffne, und andererseits der Betrachter selber, denn ohne seinen Blick nach unten wäre er nicht ins Wanken geraten. „So ist die Angst der Schwindel der Freiheit, der aufsteigt, wenn die Freiheit hinabschaut in ihre eigene Möglichkeit.“
Es waren die Surrealisten, die sich wie keine andere Künstlergruppe nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs ihrer Angst bewusst wurden und die Kühnheit besaßen, in die Tiefe der schwindelerregenden Psyche hinabzuschauen.
André Breton (1896-1966), der Philosoph der Bewegung, bekannte: „Ich glaube an die künftige Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände wie Traum und Wirklichkeit in einer absoluten Realität, wenn man so sagen kann: Surrealität.“ Wer bereit sei, weit genug in sich hinab zu steigen, finde dort eine Quelle der Kreativität. Die Schritte dorthin könnten bewusst gesetzt, nicht aber der Lauf der Schöpferkraft gelenkt werden, sonst versiege der Inspirationsstrom.
1924 definierte Breton im „Ersten Manifest des Surrealismus“ die neue „non-konformistische“ Kunstrichtung als „reinen psychischen Automatismus, durch den man mündlich oder schriftlich oder auf jede andere Weise den wirklichen Ablauf des Denkens auszudrücken sucht“. Der Surrealismus beruhe „auf dem Glauben an die höhere Wirklichkeit gewisser, bis dahin vernachlässigter Assoziationsformen, an die Allmacht des Traumes, an das zweckfreie Spiel des Denkens“.
Höhere Realität
Nach dieser Methode entstanden in Literatur, Film und Fotografie Werke, die Vision und Wirklichkeit miteinander zu einer „höheren Realität“ verbanden. Prägend waren die Schöpfungen der bildenden Kunst. Die Hamburger Kunsthalle versammelt in ihrer aktuellen Ausstellung 180 Exponate dieser Epoche. Die bekanntesten Künstler sind Salvador Dalí (1904-1989), Max Ernst (1891-1976), Joan Miró (1893-1983) und René Magritte (1898-1967). Vier (ehemalige) Privatsammlungen aus Schottland, England, Amerika und Deutschland und weitere internationale Leihgaben ermöglichen eine repräsentative Darbietung der Entwicklung des Surrealismus von den Zwanziger- bis in die Fünfzigerjahre des 20. Jahrhunderts. Bemerkenswert ist der Blick der Kuratorin Annabelle Görgen-Lammers auf die weiblichen Vertreter dieser Kunstrichtung: Leonora Carrington (1917-2011), Dorothea Tanning (1910-2012) und Leonor Fini (1907-1996). Bei ihnen gibt es Neues zu entdecken. Bei den männlichen Klassikern ist der Gang durch die elf Ausstellungsräume oft eine Begegnung mit weltbekannten Ikonen.
Auch wenn sich der philosophisch-politische Surrealismus scharf gegen das Christentum wandte, sind die Verbindungen zu Religion und Metaphysik vielfältig. Besonders deutlich wird das bei Salvador Dalí und Joan Miró. Als der Jesuitenschüler Dalí vermehrt die christliche Bildwelt adaptierte, schlug die Inquisition der Surrealisten zu. 1934 wurde er aus ihrem Bund ausgeschlossen. Der bald darauf berühmteste Surrealist blieb für die dogmatischen Bewahrer der reinen Lehre ein reaktionärer Verräter. Als 1936 Joan Miró äußerte, „jedes Staubkörnchen“ habe „eine wunderbare Seele. Aber um sie zu verstehen“, müsse „man den religiösen und magischen Sinn der Dinge wiederfinden“, führte das dagegen nicht mehr zur Exkommunikation. Vielleicht hatte sich Breton inzwischen wieder an einen Satz erinnert, den er zwölf Jahre zuvor in seinem „Manifest“ äußerte. Da hatte er in poetischer Größe und Weite formuliert: „Sagen wir es geradeheraus: das Wunderbare ist immer schön, gleich, welches Wunderbare schön ist, es ist sogar nur das Wunderbare schön.“
Der Reiz der Hamburger Ausstellung liegt darin, dass zu dem wunderbar Visionären und traumhaft Schönen verführerisch und erschreckend Verwirrendes tritt. So erstaunt René Magrittes Porträt „Reproduktion verboten“ (1937). Es zeigt die Rückansicht eines Mannes im schwarzen Anzug. Er blickt in einen Spiegel schräg vor ihm. Dort müsste sein Gesicht erscheinen. Aber wieder sieht man nur die Rückenpartie. Ist das mehr als ein Spiel mit den Naturgesetzen? Eine Antwort gibt das Buch, das auf dem Sims unter dem Spiegel liegt: Es ist Edgar Allan Poes phantastischer Roman „Die denkwürdigen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym“. Die Buchstaben erscheinen seitenverkehrt im Spiegel, also korrekt. Poes Werk ist allerdings eine Mischung aus Wahn und Wirklichkeit, eine Beschreibung menschlicher Ex-tremsituationen, eine existenzielle Entdeckungsreise. Traumgesichte werden dort zu Tatsachen. Magrittes Gemälde ist also eine Frage nach der Wirklichkeit des Ich, nach der Individualität. Wie real ist das, was wir „Persönlichkeit“ nennen?
Artistin im Zirkus
Dorothea Tannings Gemälde „Avatar“ (1947) (ver)führt in eine erotisch aufgeladene Traumwelt: Der Betrachter blickt von oben herab in die abgründige Tiefe eines Zimmers. Weit unten sind ein Kamin, darüber eine Uhr und ein Spiegel zu erkennen; durch eine halb geöffnete Tür fällt Licht. Neben einem aufgedeckten, leeren, schneeweiß-blutroten Bett wächst ein dicht begrünter Baum in die Höhe. Durch den Raum schwebt ein junges blondes Mädchen. Sie hat die Arme über ihren Kopf gestreckt und schwingt an einer Trapezschaukel - wie eine Artistin im Zirkus. Ihre Augen sind geschlossenen, der Mund ist halb geöffnet. Sie träumt tief. Das überlange Haar windet sich wie eine Nabelschnur aus der schlundartig geöffneten Baumkrone. Auf ihrem Rücken lodern feuerrote Flammenflügel. Sie nehmen von ihr Besitz. Die Seile der Schaukel sind irgendwo weit außerhalb des Bildes befestigt. Hinter dem Mädchen gleitet ein zweites Trapez durch den (T)Raum. Daran schwingt ein dunkelviolettes Abendkleid. Das Licht der Deckenlampe wirft bizarre Schatten. Dieser „Avatar“ von Dorothea Tanning ist die Verkörperung eines Lust- und Albtraums. Nachts im Schlaf erscheint eine Welt, die anziehend und zugleich furchteinflößend ist.
Eitelkeit der Künstler
In der Anfangsphase der surrealistischen Bewegung glaubte man, im Team Besonderes schaffen zu können. Als größtes Hindernis dabei erwies sich aber rasch die Eitelkeit der Künstler, von denen jeder etwas Eigenes schaffen wollte. Gelungen ist das kollektive Verfahren in einer Papiercollage (1938) von André Breton, Jacquelin Lamba (1910-1993) und Yves Tanguy (1900-1955). Man sieht eine überaus kunstvolle, doch sehr zerbrechliche Figur. Der Kopf und die Beine gehören zu einem Mann. Unter seinem Bart fährt qualmend eine alte Dampflokomotive. Als Helm trägt er das Blatt einer Pflanze, darauf kriecht eine Raupe. Seine Beine stecken in engen Hosen. Doch die Hosenträger passen nicht auf den Körper, denn der besteht aus Maschinenteilen. Sie sind wacklig aufeinander gesetzt. Das ganze Konstrukt droht bald einzustürzen. Die Collage gehört zu einer Reihe von Werken, die „Köstlicher Leichnam“ heißen. Im Surrealismus erschließt der Name eines Kunstwerks selten seine Intention. Doch hier ist es anders: Die Gestalt ist zwar exquisit, aber lebensunfähig. Die Bildkomposition ist ein „Memento mori“: Das Leben steht auf schwachen Füßen. Nichts, was Menschen schaffen, hat Bestand. Alles ist hinfällig. Ein Anstoß stößt alles um. Beim Gang durch die Räume der Präsentation wechseln die Gefühle zwischen Amüsement und Faszination, Überraschung und Irritation, Bewunderung und Begeisterung. Skurril-sinnlich ist Salvador Dalís „Lippensofa“ (1938), das er nach der von ihm verehrten US-Schauspielerin Mae West (1893-1980) entwarf. Unheimlich wirkt „Die Lebensfreude“ (1936) Max Ernsts. Das Bild zeigt aus der Bodenperspektive wuchernde Dschungelpflanzen, aggressive Phantasietiere und einen winzig kleinen Menschen. Dagegen ist Joan Mirós „Kopf eines katalanischen Bauern“ (1925) spielerisch-beschwingt - vielleicht gerade deshalb, weil keine menschliche Physiognomie zu erkennen ist. Leonor Fini läßt in „Zwei Frauen“ (1939) den Betrachter Zeuge einer geheimnisvollen, intimen Schlüssellochszene werden, und Dorothea Tanning malte in ihrer sexuell aufgeladenen „(Strom-)Spannung“ (1942) den elektrisierenden Oberkörper einer verführerischen, aber kopflosen Frau.
In der Surrealismusschau kann man den „Taumel der Freiheit“ erleben, von dem Kierkegaard schrieb. Niemand darf erwarten, dass der schwindelerregende Blick in die Tiefe der menschlichen Seele Poesiealbumbilder hervorbringt. Keine Freiheit ohne Angst. Das ist der Grundton. Nur „in der Geistlosigkeit ist keine Angst“, so der Däne, dafür sei sie „zu glücklich und zufrieden, und zu geistlos.“
Information
Dalí, Ernst, Miró, Magritte ... Surreale Begegnungen aus den Sammlungen Edward James, Roland Penrose, Gabrielle Keiller, Ulla und Heiner Pietzsch. Hamburger Kunsthalle, bis 22. Januar 2017. Katalog 288 Seiten, Euro 30,-.
Robert M. Zoske