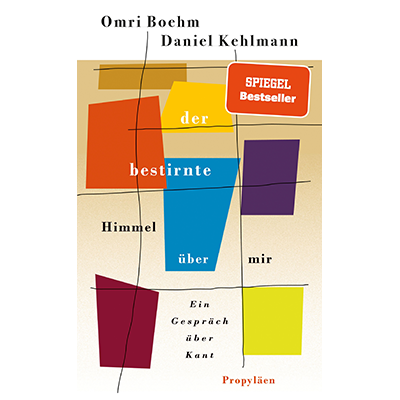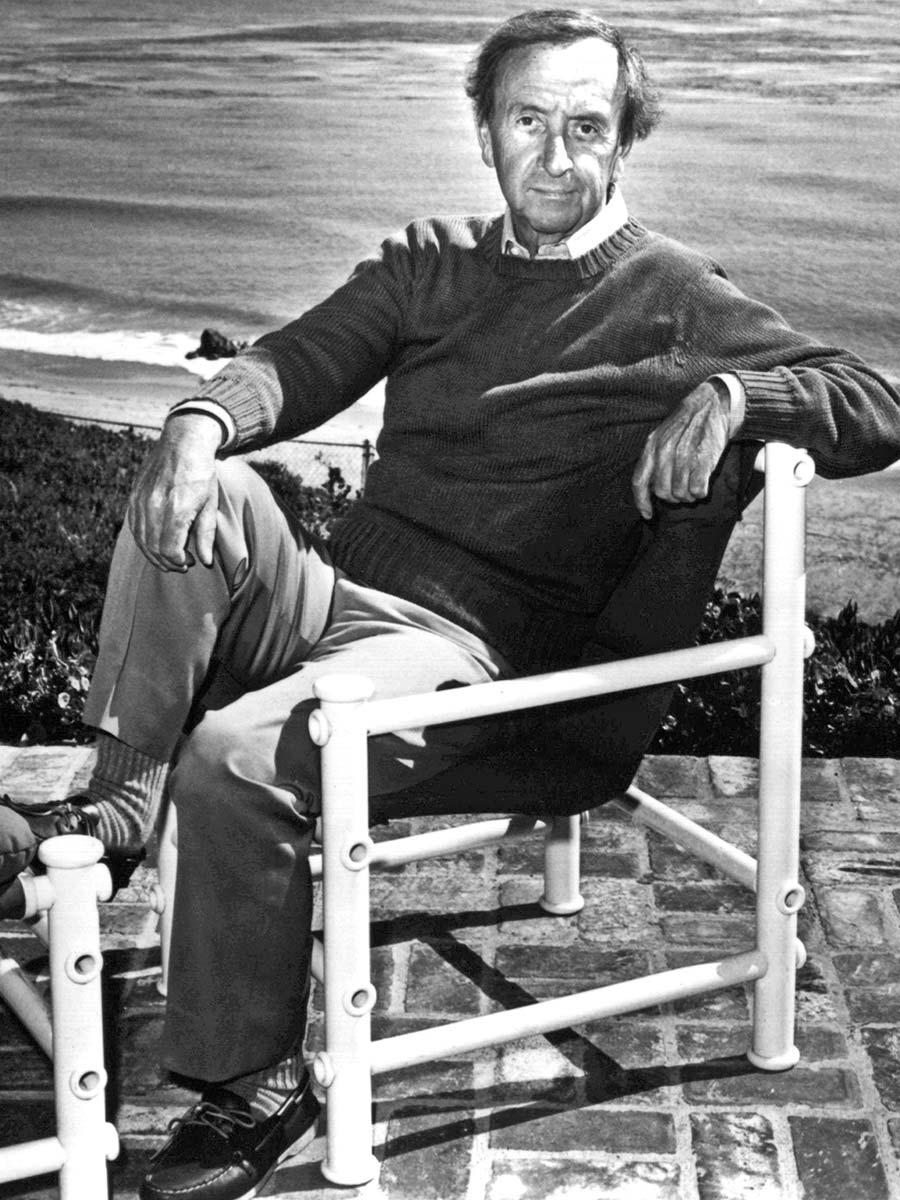
Brian Moore war ein verlorener Sohn, der sein religiöses Erbe zurückgewiesen hatte und es als ideelles Gepäck mit sich herumtrug. Die Meinung, er habe sich Religion und Katholizismus von der Seele geschrieben, beschreibt seine künstlerische und menschliche Statur aber nicht wirklich, meint der Theologe und Kulturjournalist Roland Mörchen. Vielmehr habe Moore theologische Romane geschrieben.
Der Schluss des Romans Die Farbe des Blutes hat es in sich. Kardinal Bems Zweifel sind wieder da, als er seiner Mörderin beim Austeilen des Leibes Christi ins Auge sieht. Das ist der Augenblick der Wahrheit. Bricht Gott sein Schweigen im Moment des Todes? Oder versinkt alles im Nichts? In einem früheren Roman Katholiken verliert der Abt zwar nicht sein Leben, aber auch er ist ein Mensch, der „die Hölle der Metaphysiker erlebte: die Hölle jener, denen sich Gott entzog“. Zwei Beispiele nur, doch in ihnen steckt der ganze Brian Moore.
Am 25. August 1921 in Belfast geboren, hatte er Wurzeln in beiden Konfessionen. Erst sein Großvater war zum Katholizismus konvertiert, und der Quäker Bulmer Hobson, wie Moores Onkel ein Kämpfer für die irische Unabhängigkeit, galt als Freund der Familie in einem politisch wie konfessionell zerrissenen Irland. Der Roman Dillon reflektierte später den mörderischen Nordirlandkonflikt. Als Kind musste Moore den Katechismus pauken und Prügel von seinen Lehrern einstecken, weil die katholischen Kinder besser sein sollten als die protestantischen. In ständiger Sorge um die unsterbliche Seele fragten die Priester im Beichtstuhl den Knaben aus. Eine der schlimmsten Sünden war Masturbation, Glaubensverlust sogar eine Todsünde. Moore, der Freunde unter Protestanten und Juden hatte, flirtete in seiner Jugend mit dem Sozialismus, richtete sich aber frühzeitig gegen jede Doktrin.
Strenge religiöse Erziehung sorgt selten für Festigung im Glauben und führt oft zu Traumata. Noch schlimmer war der Krieg. Nach den deutschen Bombenangriffen auf Belfast musste der 19-Jährige die Leichen einsammeln, was kaum vorstellbare Spuren in seiner Seele hinterließ. Danach ging er als UN-Beauftragter nach Polen und wanderte mit 27 nach Kanada aus. Er wurde Journalist, lebte auch in New York und in Los Angeles, wo er Kreatives Schreiben an der Universität lehrte. Moore hatte Irland geografisch hinter sich gelassen, nicht jedoch emotional.
Er war ein verlorener Sohn, der sein religiöses Erbe zurückgewiesen hatte, um es dennoch als ideelles Gepäck, wohl auch als seelische Last mit sich herumzutragen. Die Meinung, er habe sich Religion und Katholizismus von der Seele geschrieben, beschreibt seine künstlerische und menschliche Statur aber nicht wirklich. Moore bearbeitet das Glaubensthema so differenziert und so hochentwickelt, dass Kritiker zu Recht von theologischen Romanen gesprochen haben.
Psalmistische Existenzen
Das Herzstück seines Schaffens, das Krimis, Kurzprosa und Drehbücher umfasst, bilden 19 Romane, die ab Mitte der 1950er-Jahre meist im Abstand von zwei oder drei Jahren herauskamen. Moores Bücher sind nicht theologisch, weil sie unablässig theoretisieren würden. Das wäre ja auch kreuzlangweilig. Sie sind es wegen ihrer gründlichen Einlassung auf die religiöse Haltung der Figuren. Zweifel, Unglaube, Einsamkeit und Enttäuschung gerinnen zu lebensprägenden Koordinaten. Man könnte sagen, dass die Romanfiguren psalmistische Existenzen darstellen, indem sie hoffen, schreien oder Gott und die Welt nicht mehr verstehen. In Die einsame Passion der Judith Hearne zeichnet Moore das Bild einer verzweifelten, kirchentreuen Jungfer, die vergeblich einen Mann binden will und dabei ihren Glauben verliert. Zwischen den Zeilen klingt es wie ein „Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir“.
In Saturnischer Tanz erzählt Moore eine ähnliche Tragödie, nur dass er diesmal einen Lehrer an einer Knabenschule in Belfast zum Protagonisten macht. Was Frauen angeht, ist Diarmuid Devine ein Spätzünder. Er verliebt sich in die jüngere Protestantin Una, aber die erste gemeinsame Nacht scheitert. Devine ist nicht stark genug, um dem Tratsch, dem Spott und Unas Bruder, der auch noch sein Kollege ist, die Stirn zu bieten.
Moore fühlt sich in seine literarischen Charaktere, ob männliche oder weibliche, tief ein und schreibt sensible Existenzbefragungen, die so verschieden wie die Menschen sein können. Sein geistiges Profil lässt sich mit Ex-Katholik, Kryptokatholik oder Agnostiker nur unzureichend erfassen. Eher noch war er ein Kirchenemigrant mit einem unauslöschlichen Siegel. Sicher zog er sich aus dem Klerikalismus zurück, machte aber keinen Hehl aus seiner konfessionellen Herkunft. Die Suche nach spirituellem Sinn in einer entsakralisierten Welt beschäftigte ihn ein Leben lang. Der gesellschaftliche Niedergang des Christentums beunruhigte Moore so sehr, dass er sich fragte, was diese Vakanz füllen, diese Sehnsucht nach metaphysischer Erfahrung stillen und an die Stelle der Dekadenz treten könnte. Dahinter lauerte die Angst vor dem Nihilismus, die schon Dostojewski um die innere Ruhe brachte. Wo einer Gesellschaft keine Transzendenz mehr Sinn stiftet, droht der moralische Zusammenbruch. Ist alles erlaubt, gilt nichts mehr.
Eine Antwort versucht Kalter Himmel, vordergründig die Geschichte einer ernsten Ehekrise, doch wesentlich eine Innenansicht mystischer Erfahrungen, einschließlich der Verunsicherung, die sie auslösen. Moore nannte das Buch einen „metaphysischen Thriller“, was Literaturkritiker gern aufgriffen. Obwohl Alex Davenport, ein Arzt wie Moores Vater, ums Leben gekommen ist, sieht ihn Ehebrecherin Marie als lebenden Toten wieder, was ihren Gewissenskonflikt verstärkt. Im Gespräch mit einer Nonne, die typisch für Moores Glaubensgestalten auch die Gottesferne erleidet, erfährt sie: „Ich weiß nichts über Gottes Absichten. Aber ich kann Ihnen sagen, was Sankt Johannes vom Kreuz geschrieben hat: ‚Mich kann weder aufrichten noch vernichten, was mir widerfährt, sondern nur, wie ich mich dazu stelle. Für Gott zählt nur dies.‘“ Und ein Monsignore meint zu Marie gegen Ende des Romans, er glaube, „dass Gott sich uns nicht auf unverkennbare Weise offenbart“. Keiner verlange von ihr, an Wunder zu glauben.
Bei Graham Greene, mit dem die Literaturkritik Moore verglichen hat, gehören Fehlbarkeit und Sündhaftigkeit wesentlich zu den Glaubensgestalten seiner Romane, weil sie Menschen und keine Heiligen sind, wie etwa der Schnapspriester aus Die Kraft und die Herrlichkeit. Heilig werden kann bei Greene nur, wer die Niederungen des Menschlichen erlitten hat und möglichst noch drinsteckt. Greenes Romanhelden sind oft Augustinus-Naturen, denen Abirrungen und Ausschweifungen nicht fremd sind. Brian Moores Priester sündigen auch, aber sie steigen nicht unbedingt in jeden Seelenmorast hinab. Anfechtungen können sogar ein Dilemma wachrufen, wenn wie in Schwarzrock zwei Glaubensweisen radikal aufeinanderprallen: die der christlichen Missionare und jene der indianischen Ureinwohner, wobei der von Zweifeln geschüttelte Pater Laforgue in seinem religiösen Absolutismus reinen Gewissens das Falsche tut.
Doppelzüngige Schärfe
In Katholiken hat sich der Wind aus Rom gedreht. Das Buch, Moores schmalstes, ist ein Zukunftsroman. Die Amtskirche pocht auf Einhaltung einer modernen, aufgeklärten Theologie. Man ist darum bemüht, den Traditionalismus zur Räson zu bringen. Dieser äußerlich simplen Umkehrung verleiht Moore eine besondere, doppelzüngige Schärfe. Die Mönche, die auf ihrem rauen Eiland am lateinischen Ritus festhalten und in den alten Dogmen ein Bollwerk gegen die Säkularisierung sehen, treffen auf enormen Zuspruch der Gläubigen. Der Abt, der den jungen Abgesandten des Vatikans empfängt, ist formal zwar das Oberhaupt der Gemeinschaft, hat aber selbst tiefsitzende Glaubenszweifel. Moore stellt wie so oft unterschwellig aktuelle Bezüge her, braucht aber die tatsächlichen Hintergründe nur als Horizont, vor dem er existenzielle Tragödien spielen lässt, die jeden angehen. In Katholiken schwingt erkennbar der Widerstand des Bischofs Marcel Lefebvre gegen die Öffnungen des Zweiten Vatikanums mit. Die Farbe des Blutes inspiriert sich an den schwierigen Verhältnissen der Kirche in den Ostblockländern. Es gibt kein anderes Leben ruft die Diktatur auf Haiti und die Ereignisse um Pater Jean-Baptiste Aristide wach, der kurzzeitig haitianischer Präsident war.
Das Drama des Deus absconditus ist darin genauso Thema wie der befreiungstheologische Kampf gegen Armut und Korruption. Als Ich-Erzähler schildert Pater Paul Michel die Ereignisse um seinen armen Ziehsohn Jeannot, der wie er zum Priester geworden ist. Moore verschärft die bittere Lektion, dass auf die alte Diktatur nur eine neue folgt, indem er Jeannot als Präsident einer Karibikinsel einsetzt, der in der radikalen Nachfolge Jesu die Armen von der Unterdrückung befreien will. Von der Bevölkerung als Messias verehrt, muss er sowohl politischen Widerstand als auch die taktierende Haltung des Vatikans fürchten, dem das Seelenheil seiner Schäfchen wichtiger ist als deren irdisches Wohl. Tatsächlich frisst die Revolution ihre Priester. Der Ruf nach Gerechtigkeit provoziert neue Ungerechtigkeit und verlangt Blutopfer auf beiden Seiten. Jeannots plötzliches Verschwinden macht ihn zur Legende. Pater Paul verliert jedoch seinen Glauben, obwohl er früher, als Jeannot die Messe zelebrierte, ganz von Gottes Gegenwart erfüllt war. Zum Schlüsselerlebnis der Abkehr wird der Besuch bei seiner todkranken Mutter. Ein Leben lang hat sie an Gott geglaubt, doch auf dem Sterbebett geht ihr schlagartig auf, dass Gott gar nicht existiere und es kein Leben danach gebe. „Warum hatte Gott sie am Ende im Stich gelassen?“, fragt sich Pater Paul. Eine Paraphrase des Psalmwortes „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
Angst exorziert
Es scheint, als habe Moore mit dieser erschütternden Sterbeszene, die sich beim Tod seiner eigenen Mutter tatsächlich zugetragen haben soll, ex negativo die Angst vor dem Nichts exorzieren wollen, wie es Jean Paul in Siebenkäs mit der „Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei“ getan hat. Auch wenn das Anti-Bekenntnis „Es gibt kein Leben danach“ den Roman abrundet, ist es nicht so kategorisch, wie es wirkt. Pater Paul hat nur einen Schluss für sich gezogen. Moore bildet gegensätzliche Haltungen ab. Der Pater kann die Totengebete an Jeannots Grab nicht sprechen, aber ein anderer, obwohl kein Priester, hat es davor schon getan. Moore lässt bei seinen Figuren immer alle Erfahrungen zu, positive und negative, so dass auch Marie in Kalter Himmel vom Monsignore hört, dass niemand an Erscheinungen glauben müsse.
Atheismus ist wie Leben in einem Raum ohne Licht. Unglaube kann einer fehlgeleiteten religiösen Erziehung entspringen. Oder ein Mensch nimmt ihn als Widerstand gegen dogmatische Bevormundung an, die der Reflexion nicht standhält. Jeder Mensch hofft insgeheim, aus der Sache, die sich Lebenszeit nennt, heil herauszukommen. Am Schluss seines vorletzten Romans Hetzjagd beschreibt Moore wieder eine Sterbeszene, die anders konsequent ist. Noch im Augenblick des Todes zeigt der von der Kirche geschützte Kriegsverbrecher Brossard keine Reue und meint im rituellen Stoßgebet opportunistisch Verzeihung zu finden wie bei den Priestern in der Beichte. „Und als er Gott jetzt um Vergebung anflehte, entschied sich Gott, ihm vierzehn tote Juden zu zeigen.“ Dieser Schluss ist nicht rhetorisch. Bei Brian Moore geht es immer ums Ganze.
Roland Mörchen
Roland Mörchen ist Diplom-Theologe und Kulturjournalist.