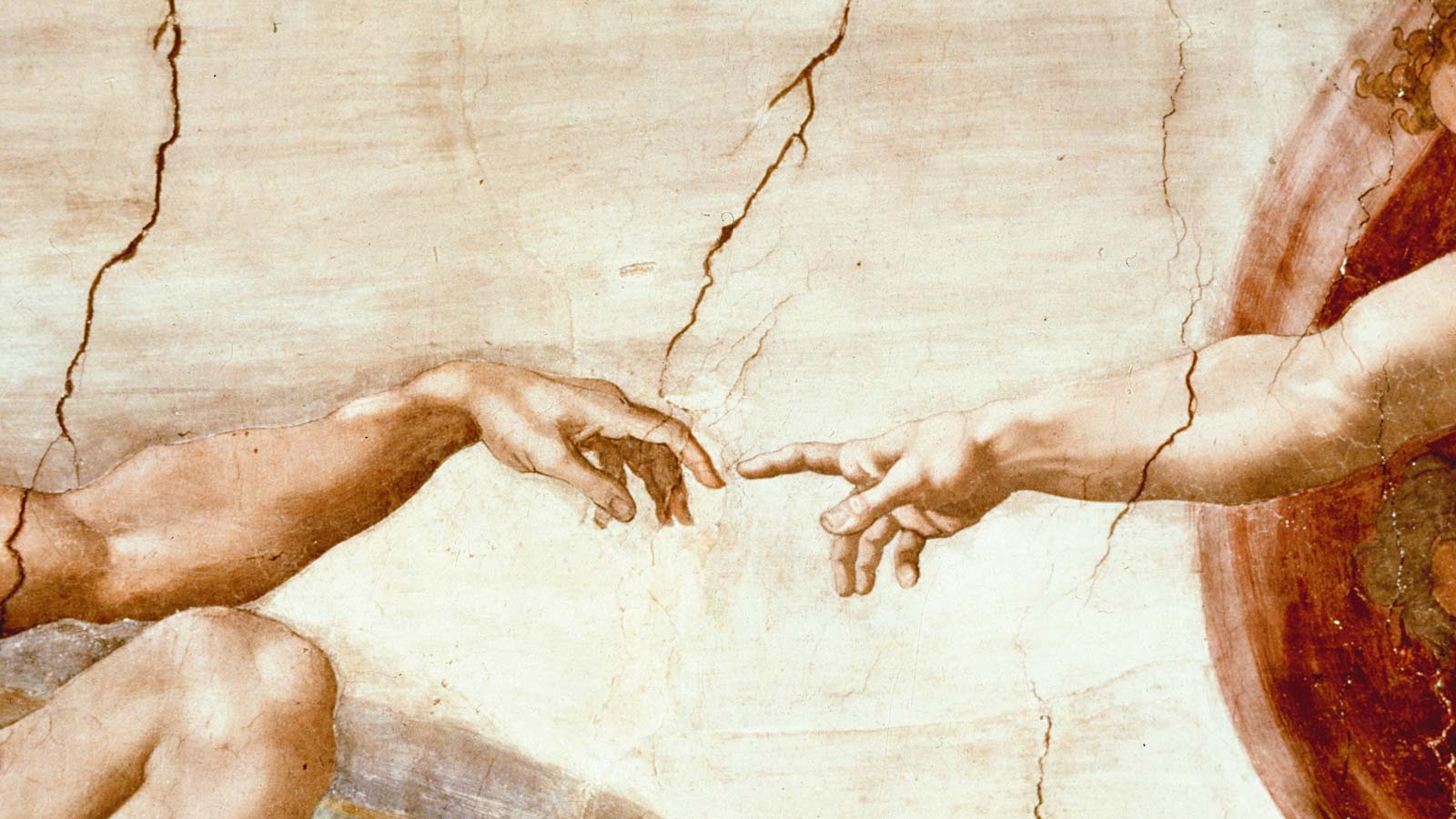
Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis hängen eng zusammen, ja, sie sind untrennbar miteinander verbunden. Diese Erkenntnis war auch schon in früheren Zeiten in der abendländischen Gotteslehre sehr verbreitet, wie der Berliner Systematische Theologe Notger Slenczka aufzeigt.
Die Toren sprechen in ihren Herzen: Es ist kein Gott.“ (Psalm 14,1). Wer kein Tor sein will, muss offenbar Gott für existent halten. Er spricht vielleicht den orthodoxen Lutheranern nach: Gott ist eine „höchstvollkommene geistige selbständige Wesenheit“, er redet über die ‚Personalität‘ und ‚Selbständigkeit‘ Gottes und meint: Gott ‚ist‘. Wenn man dann in einem Gespräch über Gott sich auf Schleiermachers Definition Gottes bezieht, das Wort „Gott“ bezeichnet das „Woher der schlechthinnigen Abhängigkeit“, dann scheint man damit zu sagen: ohne den Menschen kein Gott. Und dann greift ein bürgerlich-gebildeter Dialogpartner mit Sicherheit zum Totschlagargument: „Da landet man doch bei Feuerbach!“ Ich habe mir angewöhnt, darauf zu antworten: Na und? Und ich will erklären, warum.
„Die Toren sprechen in ihren Herzen: Es ist kein Gott.“ Die Feststellung, dass Gott ‚ist‘, scheint Gott ‚da draußen‘ zu verorten und damit unabhängig zu stellen vom menschlichen Subjekt. Das ist auf den ersten Blick beruhigend – aber: Sind wir wirklich der Überzeugung, dass Gott ‚ist‘, wie ein Stein oder ein Mensch oder eine Gurke ‚ist‘?
Nur wenige Theologinnen und Theologen der Vergangenheit hätten gesagt, Gott ist ein Gegenstand neben anderen Gegenständen. Mindestens hätten sie gesagt, Gott ist das Sein. Aber: ‚Ist‘ das Sein, wie ein Stein ist oder ein Mensch oder eine Gurke? Ein Stein oder ein Mensch oder eine Gurke ist ‚durch‘ das Sein, aber das Sein ist ja nicht, wie eine Gurke ist. Allgemeinbegriffe sind nicht Sachverhalte neben den konkreten Dingen. Daher: Wenn Gott ‚das Sein‘ ist, dann ist er kein Seiendes neben anderen Seienden. So nicht erst Heidegger oder Hegel, sondern schon Porphyrios und Aristoteles. Und diese These – Gott ist das Sein – haben auch nicht erst die theologischen Outlaws Meister Eckart oder Spinoza vertreten. Sondern Thomas von Aquin. Mit allen Implikationen, denn die These ,Gott ist das Sein“, durch das alles andere ist, wird gern als ‚panentheistisch‘ einsortiert von denen, die für jede Position ein kleines Schublädchen haben: Alles, was ist, ist in Gott. Nicht zu, Gott ist das Sein, heißt: Er ist der Inbegriff alles Seienden. Das klingt ‚panentheistisch‘, und ich sage wieder: Na und?
„Die Toren sprechen in ihren Herzen: Es ist kein Gott“ – aber so sprechen nicht nur die Toren, und nicht nur die Mystiker oder Panentheisten oder die neuzeitlichen Subjektivisten oder wie die Sortierschildchen heißen. Sondern das sagt auch Dietrich Bonhoeffer. Er wohnt zweifellos im Herzen aller Protestanten, aber er spricht dort: „Einen Gott, den ‚es gibt‘, gibt es nicht.“ Gemeint: wie immer wir ihn uns vorstellen: Gott ist kein Gegenstand neben allen anderen Gegenständen. „Natürlich nicht“ – sagen alle Befürworter der Existenz und der ‚Personalität‘ Gottes. Das haben wir ja auch nicht gemeint. Natürlich ist Gott nicht in dem Sinne, wie ein Gegenstand neben Gegenständen ‚ist‘. Nun, fragen die Toren zurück: Wenn ihr das nicht meint, was meint ihr denn dann, wenn ihr von ‚Personalität‘ oder ‚Selbständigkeit‘ Gottes redet? ‚Transzendent‘? Im Sinne Schillers: „Brüder, überm Sternenzelt, muss ein lieber Vater wohnen“? „Über“ – ernsthaft? Oder vielleicht lieber eine ‚Transzendenz durch Immanenz‘ – Gott ist transzendent als der Grund in allen Dingen? Allgegenwart Gottes? Aber was besagt das? Luther, der davon sehr ernsthaft spricht, hat sich dennoch über die damit verbundenen, allzu realistischen Vorstellungen lustig gemacht. ‚Gott in allen Dingen‘ – das werde dann vorgestellt wie das Stroh im Sack, das hinten und vorn und zu allen Seiten herausguckt.
Also: Wann immer man versucht, zu sagen, was man meint, wenn man einklagt, dass Gott nun aber auch ‚sein‘ müsse, dann wird man entweder harmlos oder sprachlos. Nicht umsonst hat sich Karl Barth, der Kronzeuge aller Gegner des Subjektivismus, in seiner Kirchlichen Dogmatik größte Mühe gemacht mit der Frage, was ‚Gegenständlichkeit Gottes‘ bedeuten könnte: nicht etwa, dass er da draußen irgendwo ‚ist‘. Sondern dass er ‚für ein Subjekt‘ ist, für sich selbst. Nur weil Gott ‚in sich selbst für sich selbst‘ ist, ist er in seiner Offenbarung ‚für den Menschen‘. Er gibt an seiner Selbsterkenntnis Anteil. Aber genau das besagt eben: Ohne ein Subjekt – mindestens das göttliche – ist ein Sein Gottes nicht zu denken, und ohne seine Geschichte mit dem Menschen auch nicht. Wer glaubt, er könne in den Spuren Karl Barths in der Gotteslehre einen ‚anti-subjectivist turn‘ vollziehen, der surft vielleicht auf der jüngsten Welle – aber er ist ein Tor.
„Die Toren sprechen in ihren Herzen: Es ist kein Gott.“ Aber offenbar kann auch derjenige, der sagt: ‚Gott ist‘, ein Tor sein. Er hat zumindest seine Begegnung mit Augustin noch vor sich: Die Anweisung des Augustin in seinen Confessiones lautet: „Geh nicht nach da draußen. Geh in dich selbst zurück. Im inneren Menschen wohnt die Wahrheit“, das heißt, da wohnt Gott. Diesen Weg ins Innere seiner selbst geht Augustin in seiner Schrift De trinitate, in der er die menschliche Subjektivität – ‚das Ich‘ – analysiert. Er zeigt, was wir von uns selbst mehr ahnen als wissen. Wenn wir zu Bewusstsein bringen, was wir ahnen, dann stoßen wir in uns selbst auf einen Grund, der uns innerlicher ist als wir selbst. Gott ‚ist‘ nicht problemarm ‚da draußen‘. Er ist nicht als Grund ‚in allen Dingen da draußen‘, sondern er ist Grund ‚im‘ Subjekt. Und dieser Grund ist kein mehr oder weniger dickes Gegenständlein im Innersten des Subjekts, sondern er ist die Bedingung der Möglichkeit seiner Einheit und Freiheit. Für die Kundigen: Wer in dieser Frage Augustin folgt, kommt um Kant und Fichte und das transzendentale Ich nicht herum.
Augustins Einsicht wurde aufgenommen, verändert, aber ererbt in den Positionen, die Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis eng, bis zur Identifikation miteinander verbanden und feststellten, dass es Gotteserkenntnis – Theologie – ohne Selbsterkenntnis nicht gibt. Nicht erst Kant und Fichte. Sondern Calvin beispielsweise, Zwingli, aber auch der größte aller mittelalterlichen Theologen, Bernhard von Clairvaux, und andere Mystiker. Es ist diese vorneuzeitliche Tradition, die sich in dem Satz Rudolf Bultmanns zusammenfassen lässt: „Will man von Gott reden, so muß man offenbar von sich selbst reden.“ Und es ist diese Tradition, in die auch Martin Luther sich mit seiner Rede von Gott einordnet, wenn er die Frage, „was ein Gott ist“, in der Auslegung des Ersten Gebots im Großen Katechismus so beantwortet: „Ein Gott wird das genannt, woher man sich versehen soll alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten, so dass … allein das Vertrauen und Glauben des Herzens beide macht: Gott und Abgott.“
Luther definiert hier Gott, und er definiert ihn, indem er den Menschen definiert. Der Mensch ist ein Wesen, das sich alles Guten versieht, also: das das Gute gerade nicht in sich selbst vorfindet, sondern es empfängt. Der Mensch ist Empfänger, und das Wort „Gott“ bezeichnet ein ‚Woher‘ des Empfangens. Also: Wer Gott definieren will, muss dabei vom Menschen sprechen: worauf immer der Mensch ausgreift und worin er sich begründet: Das ist sein Gott. Und umgekehrt: Wer den Menschen und sein Selbstverständnis thematisieren will, muss von dem sprechen, worin der Mensch sich begründet: von Gott. Denn, so Luther: „Gott und Glaube gehören zusammen.“ Wo der Glaube ist, ist Gott, und wo Gott ist, ist der Glaube.
Und eben dies ist der theologische Grund dafür, dass Schleiermacher Gott definiert als das ‚Woher der schlechthinnigen Abhängigkeit‘. Denn der Mensch ist nicht einfach da, und außerdem tut und denkt er noch dies oder jenes, sondern er ist in der Weise ‚da‘, dass er um sich selbst weiß. Sein Wissen um sich selbst ist aber keine ausgebuffte Lehre vom Menschen, sondern ein vorthematisches Wissen. Gefühl. Wir fühlen in diesem Sinne, dass wir uns in unserem Sein und in dem aktiven und passiven Leben, das wir führen, nicht selbst gesetzt haben. Wir fühlen uns absolut abhängig. Wenn wir versuchen, das auszusprechen, sagen wir möglicherweise: Wir haben uns und die Welt, in die wir eingelassen sind, nicht selbst gemacht. Und wenn wir das näher auszusprechen suchen, dann sprechen wir vielleicht vom Geschenk und thematisieren damit einen Geber. Wir sagen oder beweisen nicht etwa: Da ist etwas, und davon sind wir abhängig, sondern unser gefühltes Wissen um unsere Abhängigkeit spricht sich aus in der Rede von einem ‚Woher‘. Das Wort ‚Gott‘ bietet sich an und erlaubt es, uns und die Art und Weise, wie wir uns wahrnehmen, auszusprechen. Und umgekehrt: Wenn wir uns selbst aussprechen – und das tun wir immer –, dann müssen wir von so etwas wie ‚Gott‘ sprechen, auch wenn wir das Wort nicht verwenden. Und das heißt: Die Feststellung, dass Gott ‚ist‘, ist so gewiss wie die Aussage, dass wir selbst ‚sind‘.
„Die Toren sprechen in ihren Herzen: Es ist kein Gott.“ Der Psalmist hat ein bestimmtes Bild von Gott. Die Tradition, in die er eingelassen ist, der Tempelkult, die Erzählungen von der Befreiung, in denen er sich begründet, die Erzählung vom Weltanfang, in denen die Befreiungsgeschichte als Sinn des Ganzen ausgelegt wird – diese Erzählungen geben dem Psalmisten die Worte an die Hand, mit denen er das Bewusstsein des Beschenktseins ausspricht, und dies legt ihm aus, was ihn trägt. Und wenn er sich so getragen weiß, ist das sein Gott.
Wir als Christen haben ein bestimmtes Bild von Gott. Für uns ist die Person Jesus von Nazareth ‚Gott‘. Was meinen wir damit? Nach Melanchthon oder nach Luther nicht eine Theorie, dass hier eine Person zweier Naturen vor uns steht. Sondern es sagt etwas über uns: dass wir von Jesus von Nazareth her alles Gute erwarten. Dass er, wie der Heidelberger Katechismus sagt, unser einziger Trost im Leben und im Sterben ist. Es ist das Glauben des Herzens, also das absolut rückhaltlose Vertrauen, das in der Aussage zusammengefasst ist: Jesus Christus ist der Herr, das heißt der Gott, von dem das Alte Testament spricht (Philipper 2,9–11). In diesem Sinne ist Theologie immer narrativ. Die biblischen Geschichten von Jesus von Nazareth wecken lebensgründendes Vertrauen, so dass wir auf ihn hin getrost leben und sterben können. Dieses Vertrauen spricht die Feststellung aus, dass dieser Mensch Gott ist: der Grund rückhaltlosen Vertrauens.
Und daraufhin erfahren auch wir, wie der Psalmist, unser gesamtes aktives und passives Leben als unverfügbares Geschenk einer Hand, die unser Leben bestimmt. Wir leben dann dankbar. Diese Dankbarkeit sprechen wir aus, indem wir die Gottesanrede Jesu Christi aufnehmen: der Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und weiter: Dieses Vertrauen machen wir nicht selbst. Wir verstehen es als Gabe eben dieses Gottes und begründen dann uns und unser Vertrauen in Gott selbst. Wir sagen mit Luthers Auslegung des Dritten Artikels: „Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen.“ Gott ist nicht ohne den Glauben. In diesem Sinne „setzen“ wir Gott, indem wir vertrauen. Aber wir setzen ihn ‚uns voraus‘. Und in diesem Sinne reden wir dann wirklich davon, dass Gott ‚uns voraus‘, der Grund unserer selbst ist. Aber eben: Ohne uns, die dies sagen und darin uns selbst aussprechen, ist der Satz ‚Gott ist uns voraus‘ sinnlos.
Keine ausgebuffte Lehre
„Die Toren sprechen in ihren Herzen: Es ist kein Gott.“ Dem Tor fehlt nicht die Gottes-, sondern die Selbsterkenntnis. Er hat nicht verstanden, dass er ein Wesen ist, das vorthematisch um die eigene Abhängigkeit weiß und das gar nicht anders kann, als ein ‚Woher‘ der Abhängigkeit mitzusetzen, und zwar nicht, weil das bei Schleiermacher oder Luther oder Augustin oder Bernhard von Clairvaux oder Bultmann oder Ebeling steht, sondern weil das an der eigenen Existenz des Menschen, seinem Selbstverständnis abzulesen ist. Der Mensch fragt nach einem Sinngrund seines Lebens. Erzählungen, Institutionen, Vollzüge haben Lebensvertrauen geweckt, und dies Lebensvertrauen spricht sich zusammenfassend aus in: „Ich glaube an Gott den Vater, den Sohn, den Geist.“ Oder ganz anders darin, dass ich mein Leben an die Worte hänge, in denen der Koran vom Grund des Lebens spricht. Oder wieder anders in einer Weltanschauung, die mir Lebenssinn stiftet. Dann ist diese Rede Gottes Wort zu mir, auch ohne dass ich von ‚Gott‘ rede.
„Die Toren sprechen in ihren Herzen: Es ist kein Gott.“ Die Feststellung ‚es ist kein Gott‘ wendet sich vermutlich gegen eine Rede von Gott, die ihre lebensorientierende Kraft verloren hat. In der Tat: Einen Gott, den es nur noch ‚gibt‘, den gibt es nicht. Wer ernsthaft von Gott redet, redet davon, dass jeder Mensch einen Halt hat, an den er sein Leben gebunden hat. Er spricht von der lebensbegründenden Kraft eines Sprachspiels, in dem die Worte bereitstehen, in denen Menschen sich selbst und ihre Fraglichkeit aussprechen und in denen sie aussprechen, wovon konkret sie sich schlechthin abhängig wissen. Die Christen tun das, indem sie sich auf die Worte beziehen, die sich um das Leben des Jesus von Nazareth bilden und die ihn als Halt im Leben und im Tod aussprechen und zusagen. Wo diese Worte Vertrauen wecken, erweist sich Jesus Christus als der Herr, als Gottes Sohn. Da wird die Schöpfung als Gabe einer guten Hand, des Vaters Jesu Christi, gedeutet. Und da fühlt der Mensch, dass nicht durch ihn selbst dieses Vertrauen, in das Gott gesetzt wird, entstanden ist, und er spricht dann vom Heiligen Geist. Dann, aber nur dann, wenn er uns unbedingt, lebensbegründend angeht, ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist: Gott.
Literatur:
Notger Slenczka: Fides creatrix divinitatis. Zu einer These Luthers … in: Johannes von Lüpke u. a. (Hg.), Denkraum Katechismus, Tübingen 2009, 171 – 195.
Notger Slenczka
Notger Slenzcka, geboren 1960, ist seit 2006 Professor für Systematische Theologie (Dogmatik) an der Humboldt-Universität in Berlin.


