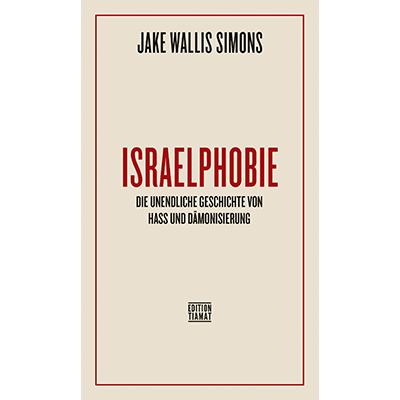Vorhang zu und alle Fragen offen
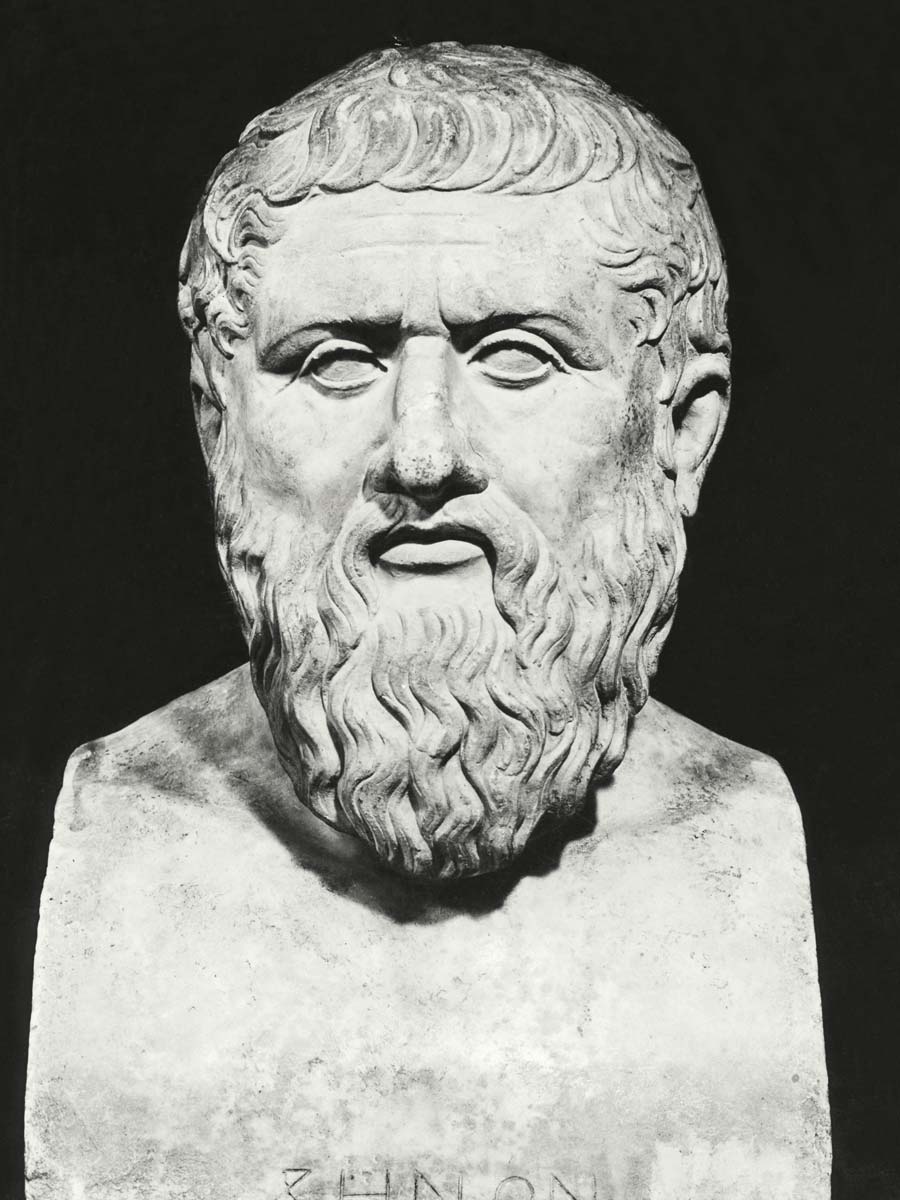
Nach Altersweisheit zu fragen, heißt, einen ziemlich antiquierten Begriff aufzurufen. Helmut Kremers, ehemaliger Chefredakteur von zeitzeichen, unternimmt es, auf die Gefahr hin, mit Antworten zurückhaltend sein zu müssen.
Altersweisheit! Man hört förmlich erschreckte Ausrufe: meine Güte! Worum soll’s gehen? Vielleicht um betagte Talkshow-Promis?
Nein. Nur um Hinz und Kunz. Die Hinzens und Kunzens, die schon längst keine best ager und schon gar nicht mehr jung sind.
Schon die Weisheit allein, ohne das Alter, ist einigermaßen unzeitgemäß. Gewiss, die Zahl jener, die darauf hoffen oder gar vertrauen, mit der Zeit klüger zu werden – sozusagen als spärlicher Ausgleich für die Beschwerden, die mit dem Alter verbunden sind –, ist nicht gerade gering.
Klugheit ist die eine Sache, Weisheit, Altersweisheit gar, die andere. Steckt im letzteren Begriff ein Selbstwiderspruch? Alter assoziiert man heute doch eher mit Demenz und Pflegebedürftigkeit. Und es ist ja wahr: Wer mit so etwas wie Altersweisheit liebäugelt, sollte sich auf den Weg machen, bevor es zu spät ist.
Damit ist es natürlich nicht getan. Nicht jeder ist, selbst bei allfälliger Langlebigkeit, dazu prädestiniert, zur Weisheit zu gelangen. Wie steht es etwa mit denen, die ihr inneres Mäntelchen allzeit in den Wind des Zeitgeistes gehängt haben, die immer „im Hier und Jetzt“ gelebt, immer „nach vorn geschaut“, auf der „Höhe der Zeit“ sich gehalten haben – oder wie die vielen Beschwichtigungsformeln für hemmungslose Anpassungswilligkeit lauten? Oder mit denen, die ihre „Weltanschauung“ beim Blick durch die eine Schießscharte, die sie sich gelassen haben, immer nur bestätigt gefunden haben?
Ostasiatisch dekorierte Esoshops
Aber die Weisheit steht ja ohnehin nicht mehr sehr hoch im Kurs, es sei denn im ostasiatisch dekorierten Esoterikshop. Vielleicht liegt das daran, dass Weisheit ohne das Bewusstsein der eigentlichen Endlichkeit kaum denkbar ist: „… lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss“ (Psalm 39,4). Aber welches Ziel? Wo der jenseitige Ewigkeits-Raum, der Himmel, abhandengekommen ist, wird die Einsicht in die Endlichkeit ein Problem. Dann muss das Nichts wohl (oder übel) als Ewiger Friede gemalt werden.
Der Unfrieden im Jenseits, die Hölle, ist ohnehin in Verruf geraten: Sie diente nicht der Hoffnung, sondern war eine Drohung, den immer wieder anders interpretierten rechten Weg hienieden, koste es, was es wolle, einzuhalten. Und auch als Racheillusion für alle Unterdrückten eignete sie sich.
Aber das Leben! Es ist schließlich das einzige Medium, in dem wir uns betätigen, heldenhaft oder schurkisch oder ganz mittelmäßig aufführen – und uns täuschen können; aber, ohne Zweifel, wir hängen an ihm und geben die Hoffnung nicht auf, dass es besser, schöner, gar schön und gut werden könnte. Das schöne, gute Leben – die Menschen strecken sich danach, auch wenn‘s eines nach eigenem Gusto bleibt.
Diese Schönheit des Lebens war allerdings sehr lange Zeit eine Sache der Privilegierten. Für viele war’s nichts damit. Menschen wurden einfach von ihren Mitmenschen verbraucht, in römischen Steinbrüchen, in Stalins Arbeitslagern, in Nazi-KZs. Die Liste ließe sich fortsetzen. Viele wurden zu Tode gequält, ganz mir nichts, dir nichts, zumeist hatte sich die allzu menschliche Lust daran ein theologisches oder ideologisches Mäntelchen umgehängt. Ungezählte sind nicht nur in Not geraten, sie sind vielmehr ihren Lebtag nicht aus ihr herausgekommen. „Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen“ – dieser lapidare Satz aus Ludwig Wittgensteins Tractatus trifft‘s.
„Etwas Besseres als den Tod findest du überall.“ Das stammt aus den sehr christlichen Zeiten und war da eher eine Blasphemie oder gar Häresie. Aber gesagt hat es ja der Esel. Er, ein Tier, konnte auf keine Erlösung hoffen. Doch drohen die vollständig säkularisierten Menschen sich nicht auf einer Stufe mit dem Bremer Stadtmusikanten wiederzufinden? Etwas Besseres als den Tod vermeinen sie überall zu finden.
Durch die Tapetentür
„Wie du anfingst, wirst du bleiben, / So viel auch wirket die Not, / Die Zucht, das meiste nämlich / Vermag die Geburt, / Und der Lichtstrahl, der / Dem Neugebornen begegnet.“ (Hölderlin, „Der Rhein“)
Heute würde man sagen: Not und Zucht: Das ist die Umwelt; Geburt und Lichtstrahl: Das sind die Gene.
Die Umwelt – das meint ja nicht nur Herkunft nach sozialer Schichtung, nach Zeitumständen und Bildungsweg, also alles Äußere, sondern auch das Innere, die Psyche. Es ist schon fast die Regel, dass der Mensch, schon das Kind, eine heimliche Flucht- und Gegenwelt aufbaut, erträumt und ausdenkt, einen Phantasie-Innenraum, der, gewissermaßen nur durch eine gut getarnte Tapetentür zu betreten, Welten umfassen kann; also nicht nur einen inneren Security-Raum, sondern einer, in dem das Weite und Offene antizipiert oder nur imaginiert wird, das von der im wirklichen Leben drohenden oder tatsächlichen erstickenden Enge befreit. Auch dieser Raum ist „wirkliches“ Leben.
Ein Einwand liegt nahe: Wird der Gang in jenen Phantasieraum zur gewohnheitsmäßigen Flucht, droht Regression, von der keine Brücke ins wirkliche Leben führt. Wenn das Ichideal so großartig oder allmachtsträumend ausfällt, dass es mit der eigenen Lebenswirklichkeit nicht mehr überein zu bringen ist – auch nicht gerade selten –, bieten sich Schein-Auswege an, in die tiefe Verbitterung etwa oder gar ins Pathologische. Wer sein Ichideal zu seiner Sonne gemacht hat, und sich, um sie zu erreichen, Flügel mit Wachs anklebt, der wird abstürzen, auf dem Boden der Tatsachen landen.
Und der ist hart. Auf dem Boden der Tatsachen gelandet zu sein – das ist eine besorgniserregende Lage. Von ihm aus geht es nicht mehr weiter abwärts, und, einmal herabgedrückt oder -gezerrt oder abgestürzt, wird auch jeder Aufschwung oder auch nur die kleinste Levitation schwer. Wenn von jemandem gesagt wird, er sei „auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden“, so klingt da eine gewisse Häme mit, so als gehe es ihm nun verdientermaßen wie dem Sprecher, dem angemaßten Repräsentanten unser aller.
Aber was sich auch immer über solche Phantasiewelten sagen lässt: Am Ende läuft es auf eine Banalität hinaus: ob sie uns nützen oder schaden. Ohne Verluste geht es in keinem Falle ab. Es gilt ja immer, eine Menge von Impulsen, Wünschen zu verdrängen, zu sublimieren, „Ambivalenztoleranz“ zu entwickeln.
Wohl dem, der die Gene und die Klugheit (und das Glück) mitbringt, sein Leben in den Griff zu bekommen, in ihm zu behalten. Und sich nicht um eine Weisheit schert, die sich darin erschöpft, sich mit der Endlichkeit abzufinden: „… dasselbe Leben, welches seine Spitze im Alter hat, hat auch seine Spitze in der Weisheit … Dann ist es Zeit und kein Anlass zum Zürnen, dass der Nebel des Todes naht“ (Friedrich Nietzsche).
Über den Boden der Tatsachen
Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Prediger puren Diesseitsenthusiasmus‘ gern behaupten, der Tod gehöre zum Leben und sei in diesem Sinne willig zu akzeptieren. Ob darin Weisheit liegt oder bloße Resignation: schwer zu entscheiden. Doch stellt sich die Frage: Kann jemand überhaupt ganz unbeschadet der Bedenken gegen Zeitgeistrittertum und Bunkermentalität sich anmaßen, Weisheit zu erstreben? Fällt sie nicht einfach zu? Ist sie nicht Gnade?
„Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“, Psalm 90, beharrt wieder auf der Einsicht in die Endlichkeit des Daseins. Das „… auf dass wir klug werden“ wird in der King James Biblel mit „that we may apply our hearts unto wisdom“ wiedergegeben, also mit Weisheit, wie auch in anderen Übersetzungen.
Auf dass wir klug werden. Ein Bonmot besagt, der Mensch beklage sich gern über seinen Körper, über seinen Verstand selten. Ob aber zu der Klugheit, die dereinst in Weisheit münden kann oder soll, ein guter Verstand ausreicht? Auch ein guter Rechner und Berechnender kann sich im Leben höchst unklug anstellen. In älteren Zeiten unterschied man daher gern zwischen Verstand und Vernunft: der Verstand die Maschine, die Vernunft das Regelwerk. Die Vernunft: gottgegeben – oder Ersatz für Gott, auch dann allerdings irgendwie metaphysisch, über den Wassern schwebend.Nein, die bloße Klugheit, die der Vernunft entspringt, die Schlauheit, macht es nicht. Eine schöne Abgrenzung der Begriffe liefert Karel Čapek in seiner kleinen Humoreske „Agathon oder Über die Weisheit“ (1920): „… ein schlauer Politiker kann ganz gut ein Spitzbube oder ein Schädling der Republik sein; aber einen vernünftigen Politiker nennen Sie nur den, der sein Amt zum Wohle der Öffentlichkeit und lobenswert verwaltet.“ Die Weisheit aber, der „ein besonderer Gemütswert innewohnt“, sie ist „so etwas wie eine Sehnsucht … Seine Vernunft vermag der Mensch in sein Werk zu legen, sie kann er durch seine Arbeit verwirklichen. Die Weisheit aber bleibt über jedes Werk erhaben.“ Das ist schön gesagt. Könnte allerdings auch heißen: Sie ist nicht nachweisbar, die Weisheit. Wer aber von dieser nicht nachweisbaren Größe wenigstens flüchtig gestreift wurde, ist – ob leider oder naturgemäß – für gewöhnlich mit dem skeptischen Blick aufs Eigene begabt. Also mit dem Zweifel. Nun ließe sich mit einiger optimistischer Spitzfindigkeit behaupten, der Zweifel schütze vor der Verzweiflung. Eine Garantie gibt es allerdings nicht.
Weisheit aus der Mode
Vielleicht ist die Weisheit deshalb in unseren wissenschaftsgläubigen Zeiten nicht mehr in Mode. Und gleich kommt auch der Zweifel zu seinem Recht: Nicht jeder, so meldet er sich, der über die Weisheit nachdenkt, wie alt er auch sei, ist deshalb schon weise. Aber möglicherweise ist diese Einsicht ja immerhin ein Anfang.
Was hat es nun also auf sich mit der Weisheit, der Altersweisheit gar? Kann sie mehr sein als ein Selbsttrost? Vielleicht, wenn von anderen geäußert, eine unverbindliche Respektsbezeugung? Genügt es, einen alten, fast vergessenen Begriff mal wieder aufs Tapet gebracht zu haben?
Vorläufig muss es wohl mit dem unvergessenen Marcel Reich-Ranicki heißen: „Vorhang zu und alle Fragen offen!“
Helmut Kremers
war bis 2014 Chefredakteur der "Zeitzeichen". Er lebt in Düsseldorf. Weitere Informationen unter www.helmut-kremers.de .