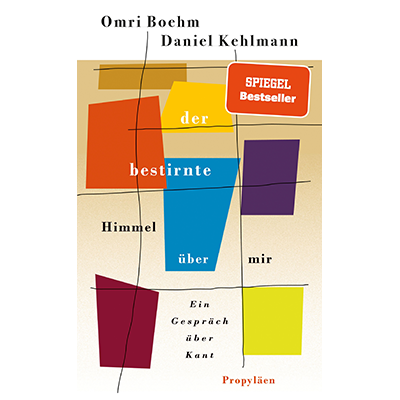Reduzierte Wirklichkeit
Im Juni übernehme ich die Herausgeberschaft einer traditionsreichen theologischen Zeitschrift, die vor fast einhundertfünfzig Jahren von einer ziemlich munteren Gruppe von Nachwuchswissenschaftlern gegründet wurde. Diese Gruppe von Mitzwanzigern wollte dem Fach wieder etwas mehr Geltung in den Wissenschaften verschaffen. Adolf Harnack, der vor neunzig Jahren starb, gehörte zu dieser Revoluzzer-Truppe. Eigentlich war anlässlich der Übergabe der Herausgeberschaft ein großer Festakt geplant, der natürlich ausfallen muss. Für diesen Festakt hatte ich in jugendlichem Leichtsinn einen Vortrag zur Geschichte der Zeitschrift zugesagt, schließlich bin ich (auch) Historiker. Historiker brauchen Quellen. Quellen zur Geschichte der „Theologischen Literaturzeitung“ gibt es wunderbarerweise, obwohl das Archiv des Leipziger Verlages, in dem die Zeitschrift bis 1945 erschien, 1943 bei einem Bombenangriff auf die Messestadt verbrannt ist. Da der Geschäftsführer des Verlag aber seit 1937 in Gotha lebte, existierte in dieser Thüringer Residenzstadt seither eine Doppelüberlieferung zum Leipziger Verlagsarchiv, von der vor einigen Jahren Reste bei einem Trödler in Berlin-Kreuzberg gefunden worden sind. Man hatte diese Zweitüberlieferung zu DDR-Zeiten an einen bekannten DDR-Verlag gegeben, der seinen Sitz im heutigen Bundesratsgebäude in Berlin hatte (damals direkt vor der Mauer gelegen). Als der Verlag nach der Wende das Gebäude für den Bundesrat räumen musste, gab er seine Archivalien einfach an einen Entrümplungsdienst.
Inzwischen sind diese Archivalien wieder in Leipzig und man kann sie in der dortigen Filiale des Sächsischen Staatsarchivs ansehen. Es gibt ein Findbuch, das die Materialien (hauptsächlich Korrespondenz mit Autoren und einigen wenigen Autorinnen) erschließt, und so machte ich mich zur Vorbereitung meines Festvortrages nach Leipzig auf. Denn auch wenn ich meinen Vortrag nun gar nicht halten darf, soll natürlich alles gedruckt werden. Gleich zu Beginn erlebte ich in dem modernen Bürokomplex eine bittere Enttäuschung. Man darf nämlich nicht etwa in den Konvoluten der Briefe blättern, sondern bekommt auf einem kleinen Wägelchen Mikrofilme, die man an einem Gerät lesen muss. Selbstverständlich ist die Entscheidung, alles zu verfilmen, gut nachvollziehbar. Wer einmal erlebt hat, wie schnell altes Papier einem unter den Händen zerbröselt oder wie rostige Büroklammern das Papier ruinieren, wird nicht wollen, dass beständig Menschen blättern, lesen und dabei immer mehr zerstören. Aber abgesehen davon, dass man am Mikrofilmlesegerät ständig den Focus scharfstellen muss und sich an die mechanischen Geräusche des automatischen Filmtransports gewöhnen muss, verliert das Archivgut alle Materialität. Man hält eine Kopie in den Händen, in denen im Grunde ein Objekt reduziert ist auf seine Funktion als Schriftträger.
Mir wurde das sehr deutlich, als ich nach meinem ersten Tag im sächsischen Staatsarchiv in Leipzig in den Verlag fuhr, der heute die „Theologische Literaturzeitung“ herausgibt. Dort präsentierte mir die Verlagsleiterin nämlich ein paar ziemlich ramponierte Aktenordner einer Firma, die bis auf den heutigen Tag solche Objekte vertreibt. Man sah den Aktenordnern an, dass es im Keller einmal feucht gewesen war, Rost bröselte heraus und die Deckel waren leicht wellig. Natürlich drohte auch bei vorsichtigstem Umblättern der Seiten jederzeit Beschädigung. Schnell begriff ich, dass es ein Teil der Gothaer Zweitüberlieferung der Leipziger Verlagskorrespondenz war, der wunderbarerweise nicht nach Berlin abtransportiert und über den Kreuzberger Trödler nach Leipzig zurückgekommen war. Ein Hefter enthielt alle Korrespondenz mit Kurt Aland – einem Kirchenhistoriker und Neutestamentler, den mindestens jeder und jede Theologiestudierende kennt, da die kritische Ausgabe des griechischen Neuen Testamentes seinen Namen trägt. Die Überlieferung seiner Korrespondenz beginnt in den vierziger Jahren, als Aland noch ein hoffnungsvoller junger Nachwuchswissenschaftler vor der Habilitation war, empfohlen von seinem akademischen Lehrer und vom Verleger schon als künftiger wichtiger Autor hofiert wurde. Und sie endete, als Aland 1958 die DDR verlassen musste und als „Republikflüchtling“ dort natürlich nicht mehr publizieren durfte.
Unter der Korrespondenz, in der es natürlich vor allem um die Zeitschrift, ihre Beiträge und entsprechende Probleme geht, ragen einzelne Briefe hervor. Darunter ein Schreiben vom August 1945, in dem auf schlechtem Papier Aland seinem Verleger berichtet, wie er die letzten Monate des Krieges verbrachte und wie sich das Leben in den unmittelbaren Wochen und Monaten danach gestaltete. Natürlich geht es auch um Verlagsgeschäfte – Aland teilt mit, dass die meisten Beiträge, die man für die „Theologische Literaturzeitung“ bereits zum Druck gesammelt hätte, unverändert erscheinen könnten und nur wenige wenig verändert werden müssten. Mindestens so interessant wie der Inhalt ist aber der Brief selbst: vergilbtes Papier, am Rand angebröselt, Schreibmaschine mit beschädigten Typen und ausgeleiertem Farbband, ein paar der Tippfehler mit schwarzer Tinte korrigiert. Im Staatsarchiv hätte ich diesen Brief gar nicht in die Hand bekommen, sondern nur seinen Text auf Mikrofilm in Schwarzweiß. Den Brief lediglich als Schriftträger.
Vielleicht fällt es mir nach Wochen digitaler Lehre, nach Monaten Videokonferenzen stärker auf als je zuvor: Neue Techniken und auch schon ziemlich alte Techniken der Vervielfältigung von Information reduzieren die Wirklichkeit. Manchmal sind solche Reduktionen unumgänglich und es gibt auch gute Gründe für solche Reduktionen. Aber nur so lange, wie wir alle noch wissen, dass wir die Wirklichkeit damit unter Umständen arg reduzieren. Wer nie einen Brief aus dem Jahre 1945 gesehen hat, dem wird im Einerlei des Mikrofilms nicht auffallen, was die Materialität solcher Briefe von denen des Jahres 1935 oder 1925 unterscheidet. Wer nie an einem solchen Brief aus Versehen eine Ecke abgebröselt hat, wird kaum Ehrfurcht vor den Stücken empfinden; der Mikrofilm macht eher mürrisch beim Durchziehen durch das Gerät.
Vor einiger Zeit wurde ausführlich über das digitale Abendmahl gesprochen. Mich hat schon damals gewundert, wie wenig dabei von den Chancen, aber auch den Gefahren der Digitalisierung an sich die Rede war. Natürlich sind Mikrofilme und Digitalisate zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Aber beide sind Realitätssubstitute. Und gelegentlich muss man mal darüber reden, was passiert, wenn immer mehr Realität substituiert wird. Wenn aus Brief reiner Schriftträger wird. Oder aus lebendiger Realität virtuelle Realität. Natürlich sollte man über solche Fragen nicht mit kulturpessimistischen Vorurteilen reden. Wenn der Brief von Kurt Aland aus dem Sommer 1945 nicht bald digitalisiert wird, ist er verloren. Aber wenn niemand mehr das Original sehen darf, geht auch etwas verloren. Und mit dem Nachdenken darüber, was man gewinnt und was man verliert, könnte ein spannendes Gespräch über Realität beginnen.
Christoph Markschies
Christoph Markschies ist Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Er lebt in Berlin.