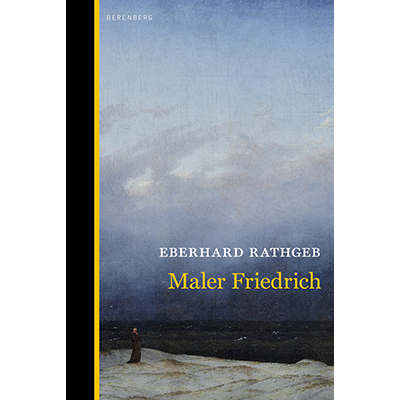Die Gedanken zu den Sonntagspredigten für die nächsten Wochen stammen von Jürgen Wandel. Er ist Mitarbeiter von zeitzeichen.
Wacher Theologe
Zweiter Sonntag nach Epiphanias, 14. Januar
Jagt dem Frieden nach mit jedermann. (Hebräer 12,14)
Menschen guten Willens bemühen sich im privaten und im politischen Bereich des Lebens um Frieden, ja setzen sich für ihn ein. Und das gilt natürlich besonders für Christen. Denn den Gott, den sie verkündigen, nennt Paulus in seinen fünf Briefen einen „Gott des Friedens“. Der Verfasser des Hebräerbriefes benutzt dieselbe Formulierung im Schlusskapitel (13,20) und mahnt, den „Willen“ dieses Gottes „zu tun“ (Vers 21). Und nach der Überlieferung des Matthäusevangeliums preist Jesus diejenigen glücklich, „die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen“ (Matthäus 5,9).
Umso mehr erstaunt, dass Christen im Laufe der Geschichte oft nicht dem Frieden „mit jedermann“ nachgejagt sind, mit den Mitchristen, die einer anderen Konfession angehörten, mit ihren jüdischen Landsleuten und mit anderen Völkern. Vielmehr haben Kirchenmänner immer wieder Gott als den Kriegsherrn verkündigt, der ihre Nation zum Sieg führt. Jüngstes Beispiel für diese Blasphemie ist das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche.
Unter dem Eindruck dieser Gewaltgeschichte ist in den evangelischen Kirchen Deutschlands nach 1945 die Überzeugung gewachsen, dass Christen sich für die gewaltlose Lösung von Konflikten zwischen Staaten einsetzen müssen. Und dafür sprechen ja gute theologische und historische Gründe.
Aber die Geschichte hält leider auch eine andere Lektion bereit: In der Nacht zum 30. September 1938 unterschrieben die Regierungschefs von Großbritannien und Frankreich das Münchner Abkommen. Es zwang die Tschechoslowakei, die von deutschsprachigen Böhmen und Mährern bewohnten Grenzgebiete an Hitlerdeutschland abzutreten. Wie andernorts feierten die Kirchen in Großbritannien Dankgottesdienste für die Abwendung eines Krieges. Und Bischöfe priesen Premierminister Neville Chamberlain als Friedenstifter.
Der Basler Theologieprofessor Karl Barth war dagegen heftig kritisiert worden, als er am 19. September 1938 in einem Brief an seinen Prager Kollegen Josef Hromádka die Tschechen zur militärischen Verteidigung ihres Landes aufforderte. Barth schrieb, es seien „merkwürdige Zeiten, lieber Herr Kollege, in denen man bei gesunden Sinnen unmöglich etwas Anderes sagen kann, als daß es um des Glaubens willen geboten ist, die Furcht vor der Gewalt und die Liebe zum Frieden entschlossen an die zweite und die Furcht vor dem Unrecht, die Liebe zur Freiheit ebenso entschlossen an die erste Stelle zu rücken!“
Natürlich ist Putin kein Massenmörder wie Hitler. Aber die Frage bleibt: Wie kann man einen Diktator daran hindern, ein Land nach dem anderen zu überfallen und zu unterjochen?
Keine Ermahnung
Dritter sonntag nach Epiphanias, 21. Januar
Naaman sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. (2. Könige 5,15)
Das 5. Kapitel des Zweiten Königsbuches erzählt, dass Naaman, der Feldherr des aramäischen Königs, an einer Hautkrankheit leidet. Nach längerem Hin und Her sucht der Nichtjude den jüdischen Propheten Elisa auf. Der lässt dem Militär ausrichten, eine Heilung sei möglich, wenn er sich „siebenmal im Jordan“ (Vers 10) wäscht. Dass Elisa ihn nicht persönlich empfängt und sofort heilt, erzürnt Naaman. Und die Aufforderung, den Jordan aufzusuchen dürfte auf ihn gewirkt haben, wie wenn man einem Hamburg-Besucher empfehlen würde, sich die Bille anzuschauen, statt die Elbe. Für Naaman sind jedenfalls „die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar, besser als alle Wasser in Israel“ geeignet, ihn zu heilen (Vers 12). Aber schließlich lässt sich der Feldherr von seinen Dienern überzeugen, es doch mit dem Jordan zu versuchen. Und siehe da: Nachdem er in dem Fluss „siebenmal“ untergetaucht ist, ist seine Haut „wieder heil“ und gleicht der „eines jungen Knaben“ (Vers 14). Und Naaman bekennt: „Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel“ (Vers 15).
So fremdartig die Erzählung von Naamans Heilung für Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts auch ist, lassen sich ihr zwei Botschaften entnehmen: Gott wirkt oft an unscheinbaren Orten und durch unbedeutende Menschen. Und so hat er auch die Juden berufen, ihn zu verkündigen. Der Hass auf sie hat viele Ursachen. Eine könnte die narzisstische Kränkung der Nachfahren von Philistern und Persern, Römern und Germanen darüber sein, dass Gott nicht sie erwählt hat, sondern die Juden. Und dann sind aus deren Reihen auch noch Jesus, seine Eltern und die Jüngerinnen und Jünger hervorgegangen und Paulus, dessen Missionsverständnis die Entwicklung des Christentums zur Weltreligion ermöglicht hat.
Und noch etwas ist bemerkenswert: Naaman bat um Vergebung, dass er auch nach seiner Bekehrung zum Gott Israels seinen König zu dessen heidnischem Tempel begleiten und dort „anbeten muss“ (Vers 18). Erstaunlicherweise ermahnte ihn der Prophet Elisa nicht und verwies auf das erste Gebot, sondern sprach zu Naaman: „Zieh hin mit Frieden“ (Vers 19).
Schwach und stark
Letzter Sonntag nach Epiphanias, 28. Januar
Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. (2. Korinther 4,7)
Wenn Paulus von „irdenen Gefäßen“, zerbrechlichen Tonkrügen schreibt, hat er sich – genauer: seinen fragilen Körper – im Blick. Denn den umtriebigen Völkermissionar setzen immer wieder heftige Schmerzattacken im Kopf außer Gefecht. Umso erstaunlicher ist, dass Gott ausgerechnet einen solchen, angeschlagenen Menschen mit einer gewaltigen Aufgabe betraut hat. Aber nicht nur bei Paulus, auch in unserer Zeit ist Gottes „Kraft … in den Schwachen mächtig“ (2. Korinther 12,9).
Doch das Bild vom „Schatz in irdenen Gefäßen“ lässt sich noch weiter fassen. So kann man darunter auch die Mittel verstehen, nicht nur die Menschen, durch die das Evangelium unter die Leute gebracht wird. Gott hat die Bibel nicht vom Himmel auf die Erde geworfen oder ihren Verfassern den Wortlaut durch einen Engel eingegeben. Sie waren bei aller göttlichen Inspiration Menschen, die wie alle anderen durch ihre Gene und die Umwelt geprägt wurden. Und so findet sich in den Schriften des Alten und Neuen Testamentes viel Menschliches, allzu Menschliches, und leider – auch Unmenschliches. Trotzdem erweist sich dieses irdene Gefäß, die Schrift, als „heilig“, indem sie immer wieder zu Gottes Wort wird, wenn sie gelesen oder in der Predigt ausgelegt wird.
Auch um die Bibel den Leuten zugänglich zu machen, bedarf es irdener Gefäße, in diesem Fall: Menschen, die Hebräisch und Griechisch in die jeweilige Landessprache übersetzen. Und auch übersetzen ist „irden“, weil Interpretation und mit Fehlern behaftet.
Zu den „irdenen Gefäßen“, die sich als Schatzkästlein entpuppen, zählen auch das Wasser bei der Taufe und Brot und Wein beim Abendmahl. Und nicht selten die Kirchenmusik, ob gesungen oder auf Instrumenten gespielt. Mitunter erschließt sie besser als eine Predigt den Schatz des Evangeliums. Oder sie lässt das Transzendente zumindest erahnen und erfahren.
Indem Gott seinen Schatz, die Botschaft der Liebe, freiwillig irdenen, also zerbrechlichen Gefäßen anvertraut, geht er ein Risiko ein. Und das ist der entscheidende Unterschied zu menschengemachten Göttern. Denn diese setzen auf Gefäße aus Gold, die scheinbar robuster als Tonkrüge sind und auch glänzen, aber innen hohl sind.
Voller Vertrauen
Sonntag Sexagesimä, 4. Februar
Und Jesus sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst – er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht. (Markus 4,26–28)
Zur Zeit Jesu arbeiteten die meisten Menschen in der Landwirtschaft. Daher dürfte sie das „Gleichnis vom Wachsen der Saat“ (Markus 4,26–29) unmittelbar angesprochen haben. Obwohl ich in der Jugend mit meinem Vater und dem Schwäbischen Albverein regelmäßig durch die engere und weitere Umgebung meiner Heimatstadt gewandert bin, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals einen säenden Bauern wahrgenommen habe. Vielleicht denke ich beim Gleichnis vom Wachsen der Saat auch deswegen eher an Eltern, Lehrkräfte und Geistliche. Denn sie säen ebenfalls.
Meine Eltern ließen mich – wie es in den Fünfzigerjahren verbreitet war – eine Woche nach meiner Geburt in der Krankenhauskapelle taufen. Und damit wurde ein Same gesät, der – aus meiner Sicht – bis heute Früchte trägt. Weil ich getauft war, besuchte ich automatisch den Evangelischen Kindergarten, den Religions- und Konfirmationsunterricht. Und meine Mutter lebte mir Gottvertrauen und ein Christentum der Tat vor. Sie engagierte sich für sozial Benachteiligte und bekämpfte die Prügelstrafe, die in den Sechzigerjahren in den Schulen verbreitet war. Ich hoffe, dass meine Mutter mit dem Ergebnis, das ihre Saat bei mir gezeitigt hat, zufrieden gewesen wäre. Aber ich weiß es nicht. Denn sie starb früh.
Auch Lehrkräfte und Geistliche sehen oft nicht, ob ihre Saat aufgeht. Entweder sterben sie vorher, oder diejenigen, die sie geprägt haben, entschwinden ihren Blicken. Ich muss einräumen, dass ich mich leider nie bei den Lehrern und Pfarrern bedankt habe, denen ich viel verdanke. Dagegen sagte jemand jüngst zu mir, für ihn sei eine Bemerkung wichtig geworden, die ich mal bei einer Predigt fallen ließ. Ich hatte sie schon vergessen.
Pfarrpersonen und Lehrkräfte werden nur dann Erfüllung in ihren Berufen finden, wenn sie darauf vertrauen, dass ihre Saat Früchte hervorbringt. Und zwar „von selbst“, auch dann noch, wenn die ihnen Anvertrauten flügge geworden sind. Das gleiche Vertrauen brauchen Eltern. Ja alle, die Jesu Reich-Gottes-Botschaft durch Wort und Tat verkündigen, brauchen den Glauben, dass sich ihr Einsatz lohnt und Früchte trägt.
Martin Luther sagte am 10. März 1522 in einer Predigt: „Ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben, sonst habe ich nichts getan. Das hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich wittenbergisch Bier mit meinem Philippus und Amsdorf getrunken habe, so viel getan, dass das Papsttum schwach geworden ist, dass ihm noch kein Fürst noch Kaiser so viel abgebrochen hat. Ich hab nichts getan, das Wort hat alles gehandelt und ausgerichtet.“
Jürgen Wandel
Jürgen Wandel ist Pfarrer, Journalist und ständiger Mitarbeiter der "zeitzeichen".