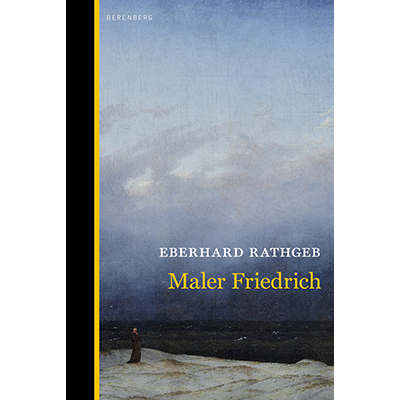Leidenschaftlich durchdachte Zuversicht

300 Jahre und kein bisschen überholt! Kants produktives Miteinander von pflichterkennender Moralität und durchdachter Zuversicht ist bis heute die wichtigste Triebkraft eines in jeder Hinsicht gewinnbringenden und menschenfreundlichen Religionsverständnisses. Warum, das beschreibt Stephan Schaede, Vizepräsident der EKD und Leiter des Amtsbereichs der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD).
Warum lohnt es sich, Immanuel Kants Überlegungen zur Religion aus dem Schrank zu holen? Nicht etwa wegen seines sittlichen Impetus, mit dem er der Religion auch in ihren praktischen Realisationsformen abverlangte, moralisch wirksam und triftig zu werden. Um weiteres moralinsaures Wasser auf die Mühlen schrumpfreligiöser Erwartungshaltungen einer Öffentlichkeit dieser Tage zu gießen, hätte es eines Immanuel Kant nicht gebraucht. Den damit verknüpften moralstrapaziösen Erwartungsfuror haben längst vor ihm und deutlich penetranter nach ihm auch die so genannten Aufklärungstheologen in den öffentlichen Raum hinausposaunt. Für die Moralisierung der Religion, für die Verbindung des Daseinsrechtes von Religion an ihre caritative, diakonische und ethisch-orientierende Wirksamkeit, hätte es eines Immanuel Kant nicht bedurft.
Kant aufzuschlagen, lohnt sich aus ganz anderen Gründen: Kant verkörpert eine originelle Mischung aus Selbstkritik und Vernunftorientierung. Ein überaus neugieriger, an allem und allen interessierter Zeitgenosse, seines Zeichens Naturwissenschaftler, der aus universaler Leidenschaft in die Philosophie gegangen ist, meldet sich im Spannungsfeld von „gestirntem Himmel über mir und moralischem Gesetz in mir“ zu Wort. Kennzeichnend für ihn ist ein ebenso leidenschaftlicher wie durchdachter Optimismus. Über so manche kirchenleitende emotional sternenstaubtrunkene apokalyptische Melancholie unserer Tage hätte er den Kopf geschüttelt. Vernunftkritische Zuversicht ist angesagt.
Zu einer religionsaffinen Haltung bei Kant mag auch sein unbeirrbarer Sinn geführt haben, sich nicht unter das Diktat einer wie auch immer gearteten Wirklichkeit zu stellen. Hier kann er zum Lehrmeister einer auf ihre Sichtbarkeit und die ambivalenten Wirkungen ihrer Sichtbarkeit fixierten Kirche werden. Wirklichkeit ist für Kant nur ein Name für das, was der erkennende Geist im Vollzug der Anschauungsformen von Raum und Zeit als Stoff der Erfahrungswelt identifiziert. Die wirkliche Kirche ist also niemals die wahre Kirche.
Wie wäre es denn, wenn die Kirche das Kantjahr 2024 einmal zum Anlass nähme, von ihrer idiosynkratischen Befassung mit selbstgemachten Krisen abzulassen, stattdessen nach einem kirchlichen Ding, „wie es an und für sich betrachtet sein möge“, zu fragen, und sich von dieser Frage inspirieren zu lassen. Das ist das eine. Das andere ist: In kantischer Perspektive gilt: Die Kirche kann, weil sie soll. Und was sie soll, liegt für ihn auf der Hand: „Stärkung des sittlichen Charakters – … Religion: Andacht und Erbauung“ notiert Immanuel Kant lakonisch in einer in den nachgelassenen Schriften dokumentierten Notiz. Kant hat hier nicht einfach zwei religionsträchtige Bestimmungen aneinandergereiht. Erbauung sei „die moralische Folge aus der Andacht auf das Subjekt, welche einen neuen Menschen als einen neuen Tempel erbaut“, schreibt er in einer Anmerkung seiner Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft von 1793/94. Der Titel ist Programm. Vernunft ist auch hier wie so oft lebensbestimmend für Kant, eine Vernunft, die aber den Eigensinn von Religion anerkennt und ihm eine eben vernünftige Fassung verleihen möchte.
So unreformatorisch ist das gar nicht. Als Martin Luther in seinem Kleinen Katechismus zum dritten Glaubensartikel eingeschärft hat, „das ich nicht aus eigener vernunfft noch krafft an Jehsum Christum, meinen Herrn, gleuben oder zu im kommen kann …“, meinte er mitnichten, dass ein Mensch ohne Vernunft zu Gott kommen könne oder solle. Vernunft war auch bei Luther gefragt. Die Reformation wollte es schon lange vor Immanuel Kant einfach wissen. Einen der Kernsätze aus Martin Luthers De servo arbitrio hätte Kant ohne weiteres mitsprechen können: „Der Christ sei verflucht, der nicht versteht, was er glaubt“. Und Kant wollte es auch in Fragen der Religion einfach wissen. Der erkenntniskritische Kant ist nur der halbe Kant. Die Frage nach der Belastbarkeit metaphysischer Erkenntnis brannte Kant auf den Nägeln. Bei der Beantwortung dieser Frage weigerte sich Kant, mit einem Christian Wolff, dem deutschen Universalgelehrten der frühen Aufklärung, zum metaphysischen Lachen in den Keller zu gehen. Dessen überanstrengte Herleitungen der Notwendigkeit von Gott und Theologie hatten die Vernunft in Kants Augen hoffnungslos überstrapaziert. Diese Form einer philosophischen Theologie fand er maßlos übertrieben. Im Unterschied zu den Wolffianern war sein Umgang mit theologischen Topoi von einer augenzwinkernd leichtgängigen Hermeneutik bestimmt. Und das geht bei ihm so: „Die medizinische Fakultät würde sich das erbliche Böse etwa wie den Bandwurm vorstellen, von welchem wirklich einige Naturkündiger der Meinung sind, daß, da er sonst weder in einem Elemente außer uns noch (von derselben Art) in irgend einem andern Tiere angetroffen wird, er schon in den ersten Eltern gewesen sein müsse.“ David Hume wiederum, sein etwas älterer schottischer Zeitgenosse, dessen Sinn für Humor Kant uneingeschränkt teilte, war ihm argumentativ mit seiner Tendenz zur Reduktion auf sensualistische und empirische Intuitionen und seiner ebenso skeptischen und metaphysikfreien Philosophie wiederum zu läppisch. Hume hatte theologisch maßlos untertrieben.
In den Augen von Kant ging deutlich mehr. „Es ist durchaus nötig, dass man sich vom Dasein Gottes überzeuge; es ist aber nicht ebenso nötig, daß man es demonstriere“, hielt Kant 1763 fest. Später wird er klarstellen: Gott lässt sich nicht beweisen. Gott muss als Gottesidee, genauer als Ideal bestimmt werden, auf das eine vernünftige menschliche Gedankenführung hinauslaufen muss, die den Menschen wiederum ethisch in Gang bringt. Diese Gedankenführung mündet allerdings in eine Provokation der Vernunft. Sie muss bezwingend praktisch vernünftig an etwas festhalten, was sich theoretischer Vernunft entzieht. Reichlich grobkörnig zusammengerafft und bloß markiert: Der so genannte ontologische Gottesbeweis verfängt nicht. Selbst wenn Gott als „allerrealstes Wesen“ gedacht werden muss, ist die Existenz kein Prädikat dieses Wesens, sondern nur eine ontologische „Position“sangabe, wie Kant formuliert. Auch der so genannte physikotheologische Gottesbeweis muss scheitern: Selbst wenn jemand meine, die Welt sei derart schön und zweckmäßig geordnet, dass sie nur ein weises Wesen gegründet habe. Wer sagt denn, dass der entsprechende Weltbaumeister ein Gott sein müsse? Es könnte ja auch ein kleiner grüner Urknallanzünder gewesen sein. Schließlich bleibt auch der kosmologische Gottesbeweis fraglich: Kant lässt den Gott der Gottesbeweise selbst schwindelig werden. Der nämlich müsse sich auch als allernotwendigstes Wesen die abgründige Frage vorlegen: „Aber woher bin ich denn?“
Epochale Veränderung
Kants Widerlegung der klassischen Gottesbeweise fand alsbald in die dogmatischen Lehrbücher der Folgezeit Eingang. In der Kombination mit seinem berühmten Diktum aus der Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft „Ich musste … das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“, wurde es als wissenschaftstheoretisches Argument genutzt, um christliche Glaubensüberzeugungen diverser Art auf weiten Raum zu stellen. Das sei Kantgebrauch, keine sachgerechte Kantrezeption, meinte Emanuel Hirsch dazu. Die Veränderung in der Zuordnung von Wissen und Glauben durch Kant war epochal. Sie führt bei Kant in die neue Form einer ethischen Rechtgläubigkeit, die im Blick auf ihre positiven Setzungen ausgesprochen spartanisch daherkommt. Die Vernunft wird als Platzanweiserin zugleich zu einer restriktiven Grenzschützerin der Religion. Kant hat die theologische Begründungsrichtung philosophisch umgekehrt: Nicht weil es Gott gibt, muss ich sittlich handeln. Sondern weil ich als Mensch sittlich handeln kann, muss es die Gottesidee geben. Denn der sittlich hingerissene Mensch wird dadurch zu einer weltläufigen Persönlichkeit, dass er den Pflichtgedanken in das Zentrum seiner Humanität stellt.
Kant kann das so sagen: Ein der sittlichen Pflicht hingegebener Mensch heilige die Menschheit in seiner Person durch das moralische Gesetz. Genauer: Pflicht erhebe aus drei Gründen. Pflicht erhebt erstens, weil sie über alle kleingeistigen Nützlichkeitserwägungen erhaben ist. Sie fragt nicht: Was habe ich davon? Pflicht erhebt zweitens, weil sie sich nicht um das schale Glück einer Spaßgesellschaft schert. Sie fragt nicht: Macht das denn auch Spaß? Pflicht erhebt schließlich drittens als Ausdruck höchster menschlicher Souveränität. In Gestalt einer „Achtung vor dem moralischen Gesetz“ entsteht sie in aller Freiheit. Das moralische Gesetz ist unbedingt, allgemein und autonom. Es wird nicht fremd übergestülpt.
Vor diesem Hintergrund ist kein Zufall, dass der gleichermaßen vom Protestantismus wie Liberalismus geprägte Theodor Heuss von seinen Mitarbeitenden verlangte, den berühmten Passus zur Pflicht aus der Kritik der praktischen Vernunft wie einen sittlichen Katechismus auswendig zu kennen: „Pflicht, du erhabener großer Name, der Du nicht Beliebtes, was Einschmeichelung bei sich führt, in dir fassest, sondern Unterwerfung verlangst, doch auch nicht drohest, was natürliche Abneigung im Gemüte erregte und schreckte, um den Willen zu bewegen, sondern bloß ein Gesetz aufstellst, welches von selbst im Gemüte Eingang findet, und doch sich selbst wider Willen … Verehrung erwirbt.“ Die religiösen Anspielungen sind mit Händen zu greifen. Weil der Mensch in der Lage ist, „nur nach der Maxime“ zu handeln, „durch die“ er „zugleich wollen kann […], daß sie ein allgemeines Gesetz werde“, wird er, in einer Religionsmetapher gesprochen, zum Einwohnungspunkt der Pflicht, ist er als Person und Ort der Pflichterfüllung niemals nur Mittel, sondern immer zugleich Zweck. Darin besteht nach Kant ausdrücklich die Würde des Menschen beziehungsweise die „Heiligkeit der Person“.
Ritualphänomenologisch karg
Dabei ist die Pflichterfüllung keine mechanisch reaktive ethische Kraft. Sie ist, ohne Untertreibung, kreativ. Indem ein Mensch in Freiheit erkennt, was im konkreten Fall seine Pflicht ist, setzt er neue Lebensgestaltungsanfänge. Pflichtbewusstsein ist Gottesverehrung, mehr noch, ist die einzig denkbare Form eines vernünftigen Gottesdienstes in den Grenzen der Vernunftreligion. Insofern wird bei Kant das Gewissen zum einzigen Spielfeld, in dem sich religiös Belastbares abspielen kann. Deshalb hat Kant überaus virtuos alle repräsentativen Außenverhältnisse und Stellvertretungsverhältnisse der christlichen Soteriologie (Lehre von der Erlösung) und Ekklesiologie (Lehre von der Kirche) in das Gewissen nach innen verlegt. Das führt zu virtuosen Transformationen der klassischen Lehrbildungen der Christologie in eine religiös-anthropologische Innenanschauung hinein. Wer Jesus Christus war und wie er war, wird dabei zu einer anregenden Strukturfolie zur Beschreibung menschlicher Innenansichten im Spannungsfeld dessen, was der Mensch soll und was er sollen zu können faktisch nicht einzulösen vermag. Die Folgen dieser Transformation sind ritualphänomenologisch einigermaßen karg. Diese Folgen muss der von Kant vertretene Vernunftglaube nun einmal hinnehmen. Alle Formen, die spirituelle Verdichtungen im menschlichen Subjekt als Königsweg von Religiosität identifizierten, waren Kant suspekt. Hier urteilt er scharf: „Himmlische Einflüsse in sich wahrnehmen zu wollen“, komme einer „Art Wahnsinn“ gleich (Religionsschrift IV, Zweiter Teil, §2). Zuletzt ist es so: Religion „unterscheidet sich nicht der Materie … nach in irgendeinem Stücke von der Moral, denn sie geht auf Pflichten überhaupt“. Diese ethische Universalität hat religionstheoretisch bemerkenswerte Folgen. Denn Religion ist Kants Urteil zufolge „nur eine einzige und es gibt nicht verschiedene Religionen, aber wohl verschiedene Glaubensarten an göttliche Offenbarung und deren statuarische Lehren“ (Streit der Fakultäten).
Kant war religionspolitisch klug genug, insbesondere der Glaubensart des Christentums systematisch etwas abzugewinnen. Das Christentum als, „so viel wir wissen, die schicklichste Form“ der Religion könne besonders effizient in den Vernunftglauben hineinrufen. Dafür müsse allerdings der Vernunftglaube zum Maßstab für die Frage werden, was an der christlichen Offenbarung dran ist. Sola ratione statt sola scriptura! Oder anders: „Alles kommt in der Religion aufs“ rational reflektierte „Tun an, und diese Endabsicht mithin auch ein dieser gemäßer Sinn muß allen biblischen Glaubenslehren unterlegt werden.“
So kommt es für Kant genau dann zum religiösen Himmel auf Erden, wenn der statuarische Glaube zum Vernunftglauben heranreift. Kant denkt dabei in der Tat an einen Reifeprozess. Denn die durch eine kritische Vernunftorientierung ausgerufene „Revolution der Denkungsart“ agiert auf dem religiösen Feld gerade nicht revolutionär-umstürzend, sondern reformorientiert. Ganz der vernünftigen Religionspraxis entsprechend, geschieht der entsprechende Reifungsprozess in aller rational gesteuerten Freiheit. Kant war davon überzeugt, dass diese Form eines selbstkritischen Rationalismus den Tiefsinn der Lebenszusammenhänge ohne jede zerstörerische Absicht zu kultivieren vermag.
Und hier kommt auf der Linie seines kritisch aufgeklärten Optimismus abermals Gott als eine die Lebensverhältnisse orchestrierende Instanz ins Spiel. Als Garant dafür, dass Pflicht im Gesamtprozess des ethisch verantworteten Lebens nicht ins Unglück stürzt, sondern zu etwas führt und zuletzt glücklich macht, „muss“ für Kant Gott zwingend postuliert werden.
Unsterblichkeit als regulative Idee
Die Literatur hat deshalb im Unterschied zu Kant selbst von einem „moralischen Gottesbeweis“ sprechen zu müssen gemeint. Das ist falsch. Denn die Notwendigkeit dieses Gottespostulats gibt lediglich der praktisch-persönlichen Überzeugung in ihrem Geltungsanspruch Ausdruck, ist also nicht weniger, aber auch nicht mehr als Resultat der Forderung eines menschlichen Vernunftvermögens, das praktisch werden möchte. Bewiesen ist damit nichts. Und die Frage muss offen bleiben, ob der darin liegende Vernunftoptimismus Recht behalten wird. Auch bleibt fraglich, wie triftig es ist, Gott als Instanz zu denken, die eine auseinanderdriftende Sinnen- und Sittenwelt, die Diskrepanz zwischen sittlichem Anspruch und faktischen Handlungsketten, die individuellen und gesamtgesellschaftlichen Bestrebungen zusammenhält. Ebenso faszinierend wie problematisch ist, die Unsterblichkeit der Seele als regulative Idee, also ein Konzept zu behaupten, auf das es hinauslaufen muss, angesichts der Einsicht, dass in einem endlich-vernünftigen Leben die volle Einheit des Menschen mit dem moralischen Gesetz nur in Gestalt eines unendlichen Strebens erreichbar sei. Faszinierend an Kants rigoros ethischer Religionskonzeption aber ist und bleibt deren an Fragen der Religion interessierte Ernsthaftigkeit, die vermeidet, was sich dieser Tage mit einer rigoros ethischen Religionshaltung verknüpft, nämlich ethisch rigoristisch zu sein und den ethischen Rigorismus an die Stelle von Gott selbst zu setzen.
Gegenüber dieser hoffnungslosen Form der Religiosität gibt Kants Religionsphilosophie weiter zu denken und erteilt einer christlichen Theologie eine produktive Lektion: Das, was der christliche Glaube zu sagen und zu gestalten vermag, sollte durchdacht sein. Eine solche Theologie nimmt nicht statuarisch hin, was christliche Dogmatik ihr vorsetzt. Sie wird aber mit der Energie des menschlichen Intellekts den Freiraum, den der christliche Glaube rituell, intellektuell und emotional bietet, gegenüber dem Grenzwächtertum der (reinen) Vernunft heiter ausweiten.
Stephan Schaede
Stephan Schaede, (*1963) ist Leiter des Amtsbereichs der VELKD
und Vizepräsident im Kirchenamt der EKD in Hannover. Zuvor war der promovierte Systematische Theologe von 2021 an Regionalbischof im Sprengel Lüneburg und von 2010 bis 2020 Direktor der Evangelischen Akademie in Loccum.